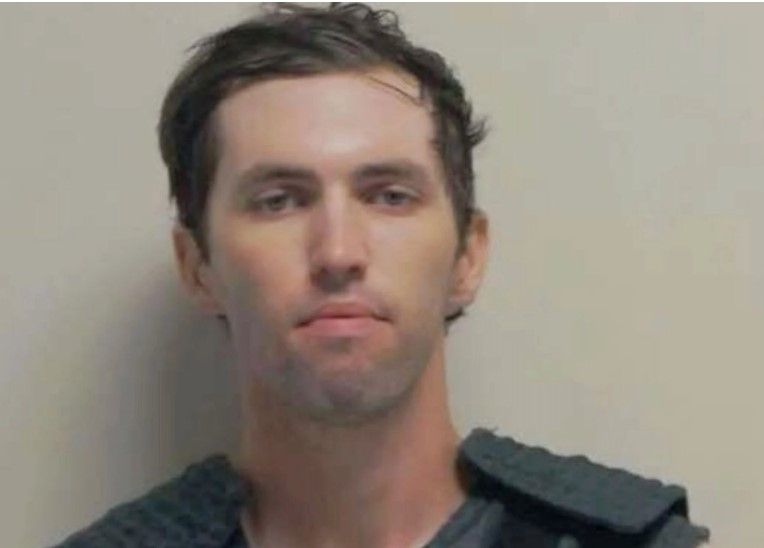Studie kritisiert Glücksritter Staat für heikle Vergabe der Swisslos-Millionen
Es ist eine sichere Wette. Bei jeder Rubbel-Niete, jedem glücklosen Lottoschein und jedem falschen Sporttipp gewinnt der Staat. Das Geld der Glücksspielerinnen und -spieler äufnet die Swisslos-Fonds der Kantone.
Die Summe ist beträchtlich: Jährlich fliessen über 600 Millionen Franken in diese speziellen Kassen. Wie problematisch der Umgang mit diesem Füllhorn ist, zeigt eine aktuelle Studie des liberalen Thinktanks Avenir Suisse.
Das Gesetz schreibt vor, dass die Kantone mit Swisslos-Geld nicht einfach ihre Staatskassen aufpolieren dürfen. Die Mittel müssen für gemeinnützige Zwecke der Gesellschaft zurückgegeben werden. Der Schweizer Föderalismus bringt es mit sich, dass die verschiedenen Kantone dieses Gesetz allerdings sehr unterschiedlich auslegen.
Bis zu 22 Millionen alleine für die Verwaltung
Eine Baustelle orten Studienverfasser Jürg Müller und Basil Ammann in der Ineffizienz. 78 verschiedene Kassen führen die Kantone. Spitzenreiter ist der Kanton Luzern, der die Vergabe möglichst kompliziert organisiert: Zuerst verteilen dort die Regierungsräte das Geld unter sich und den Departementen, und dann wird es wieder verschiedenen Zwecken zugeschrieben.
Über die Jahre habe sich so ein Portfolio von ganzen 18 verschiedenen Swisslos-Fonds angehäuft, die alle verwaltet werden müssen. Die Avenir-Suisse-Studie kommt zum Schluss, dass schweizweit bis zu 22 Millionen Franken alleine dafür ausgegeben werden, um das Geld zu verteilen. «Die Regeln zur Ausschüttung sind fast nicht überschaubar, da höchst unterschiedliche Verteilmechanismen zum Tragen kommen», heisst es in der Studie.
Ein weiteres Problem ist die Definition von «gemeinnützig». Die Regierungen – meist sind sie für die Swisslos-Vergabe zuständig – legen das Kriterium recht grosszügig aus. Schlagzeilen machte jüngst der Kanton Solothurn, der eine neue Kaserne im Vatikan mit 50’000 Franken Swisslos-Geld bezuschussen wollte.
Wiederholungstäter ist zudem Basel-Stadt, wo sich das Standortmarketing bediente, um wahlweise kommerzielle Musicals, die Swiss Indoors oder einen Weihnachtsmarkt zu alimentieren. Der Lausanner Staatsrechtler Etienne Grisel nannte die Swisslos-Töpfe einst in dieser Zeitung sogar «eine Art legale schwarze Kassen».
Für jeden einen Batzen ins Portemonnaie
Hauptproblem sind für Müller und Ammann aber die Mehrfach-Rollen, die der Staat im Glücksspiel einnimmt. Einerseits tritt er als Anbieter auf, denn Swisslos und auch das Pendant aus der französischen Schweiz, die Loterie Romande, sind vollständig in staatlicher Hand.
Andererseits ist er auch Regulator, der die Spielsucht bekämpfen soll. Und schliesslich ist er Nutzniesser, der Geld zu verteilen hat. «Die heutige Dreifach-Rolle ist alles andere als zeitgemäss und widerspricht sämtlichen Grundsätzen moderner Corporate Governance. Interessenkonflikte sind programmiert», schreibt dazu Peter Grünenfelder, Direktor von Avenir Suisse im Vorwort zur Studie.
Die Studienverfasser haben deshalb einen eigenen Vorschlag, wie der Obolus der Gambler künftig an die Gesellschaft zurückfliessen soll: direkt als staatliche Pro-Kopf-Rückverteilung. Avenir Suisse bezieht in diese Rechnung nicht nur das Swisslos-Geld, sondern auch die Erträge der Spielbanken ein, welche aktuell in die AHV fliessen.
Damit erhöht sich der Topf auf fast eine Milliarde Franken «Spielgeld». «Wäre dieses Geld zu gleichen Teilen an die Bevölkerung rückverteilt worden, hätte jede Person in der Schweiz rund 115 Fr. erhalten – bei einer Familie mit zwei Kindern käme so ein jährlicher Betrag von rund 460 Fr. zusammen», schlussfolgern Müller und Ammann.
Inhaltlich ist die Studie brisant. Das Risiko, dass sie toter Buchstabe bleibt, ist dennoch gross. Zum einen profitieren viele staatliche Akteure vom aktuellen System. Zum anderen hat die Schweizer Stimmbevölkerung erst vor vier Jahren ein neues Geldspielgesetz beschlossen.
Es ist ein politischer Teufelspakt, dem das Schweizer Stimmvolk vor zwanzig Jahren zugestimmt hat: Um der notleidenden AHV einen finanziellen Zustupf zu geben, wurden offiziell Spielbanken erlaubt, 21 Casinos haben derzeit eine Konzession. Von dem 2019 erwirtschafteten Bruttospielertrag in Höhe von 765 Millionen Franken flossen dadurch 312 Millionen Franken in die Kasse der AHV. Attraktiv sind die Spielhöllen jedoch vor allem für die Kantone. Sie profitierten 2019 von den Spielbankenabgaben in der Höhe von 52 Millionen Franken, wobei nur gerade 8 Millionen zweckgebunden eingesetzt, weitere 44 Millionen jedoch als stille Einnahmen verbucht wurden. Allein die Tessiner Staatskasse verbuchte auf diese Weise 17,3 Millionen. Dazu generieren die Casinos Steuereinnahmen in Höhe von rund 18 Millionen Franken und bieten Arbeitsplätze.
Die Konzessionen müssen per 2025 erneuert werden, die Goldgräber versuchen bereits ihre Claims abzustecken. Im Wallis sind bereits drei neue Casino-Projekte in Vorbereitung. Die Casinogruppe aus Baden will auch in Solothurn und Locarno tätig werden.
Gemäss einer neuen Studie im Auftrag des Bundesamts für Wirtschaft (Seco) ist die heutige Vergabepraxis des Bundesrates problematisch. Es mangle an Transparenz, Chancengleichheit und einer effizienten Zuteilung. Seit gestern ist klar: Gross ändern wird sich daran so schnell nichts. Im Gegenteil, der Bundesrat hat beschlossen, die Zahl der Konzessionen auf 23 zu erhöhen. Den umgekehrten Weg hat eine Initiativgruppe im benachbarten Liechtenstein beschritten. Nachdem in den vergangenen zehn Jahren elf Casinos aus dem Boden geschossen sind, verlangen die Initianten einen einfachen Zusatz in der Verfassung: «Der Betrieb von Spielbanken ist verboten.» (cm)