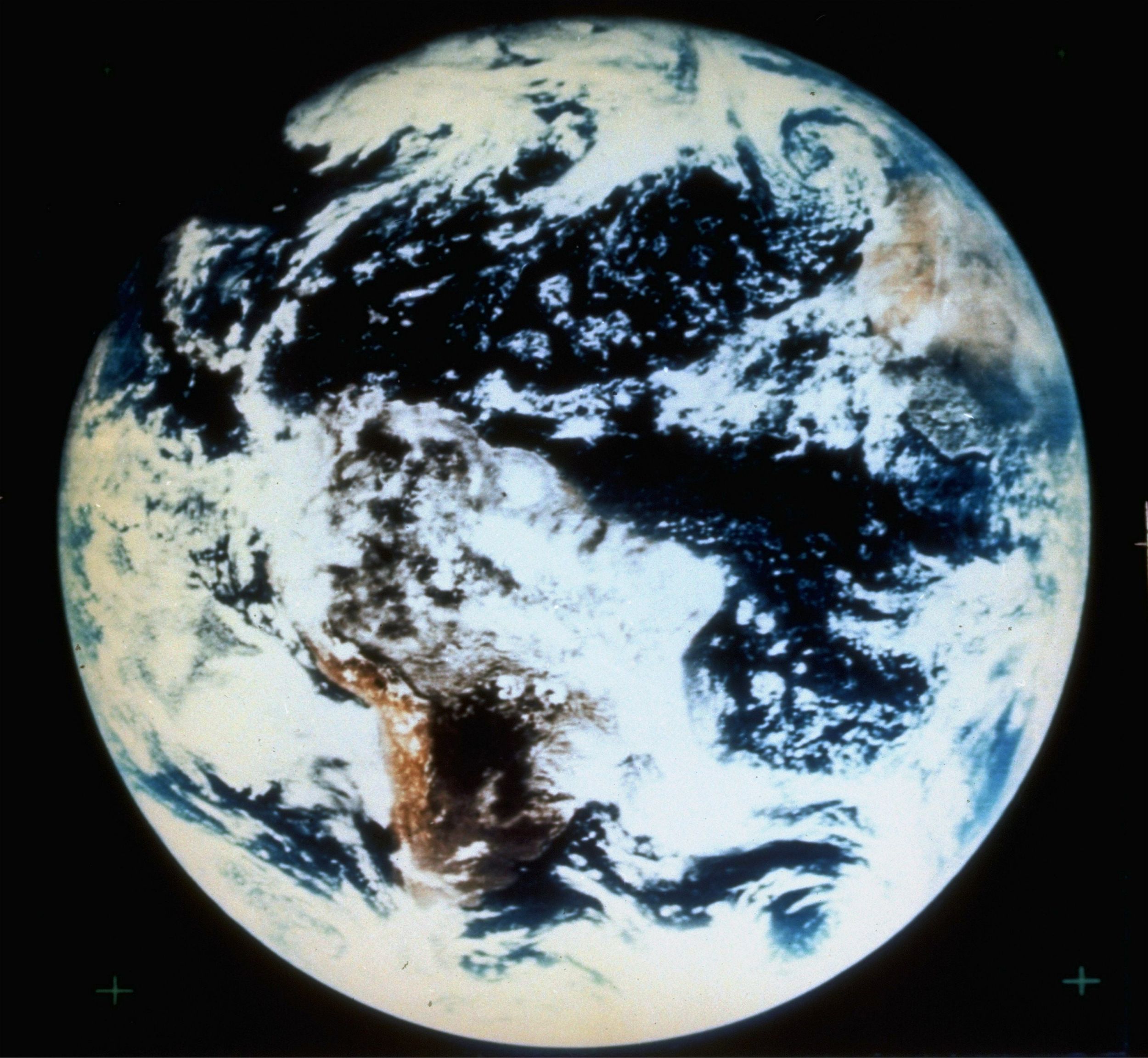Die Häufigkeit von Starkregen in den Alpen verdoppelt sich
Im Juni 2018 erlebte Lausanne eine Sturzflut von oben: Innerhalb von nur zehn Minuten fielen 41 Millimeter Niederschlag. Grosse Teile der Stadt wurden überschwemmt, es entstanden Schäden in der Höhe von 32 Millionen Franken. Solche kurzen, extremen Ereignisse sind in der Schweiz bislang noch selten. Das schreiben Forschende der Universität Lausanne.
Doch mit der globalen Erwärmung sei zu erwarten, dass sie künftig häufiger auftreten werden – insbesondere in den Alpen und ihrem Umland. Denn warme Luft kann pro Grad Celsius 7 Prozent mehr Feuchtigkeit speichern, und so werden Gewitter wahrscheinlicher, die ohnehin schon häufiger in den Bergen als im Flachland vorkommen.
In einer neuen Studie zeigen Forschende der Fakultät für Geowissenschaften und Umwelt der Uni Lausanne in Zusammenarbeit mit der Universität Padua, dass ein Temperaturanstieg um 2 Grad Celsius die Häufigkeit kurz andauernder Sommerstürme in der Alpenregion verdoppeln könnte. Das haben die Forschenden anhand von Daten von fast 300 Wetterstationen in den Alpen herausgefunden – untersucht wurden Rekordniederschläge in den Jahren 1991 bis 2020 und die damals herrschenden Temperaturen.
Gerade bei Sommerhitze sind Gewitter beziehungsweise ist der Regen zwar willkommen. Doch Nadav Peleg, Erstautor der Studie, sagt: «Das plötzliche und massive Auftreten grosser Wassermengen verhindert deren Versickerung im Boden.» Dies könne zu Murgängen, also Erdrutschen, führen, mit entsprechenden Schäden an der Infrastruktur und mitunter auch Todesfällen. Peleg rät dazu, dass Städte ihre Entwässerungssysteme ausbauen sollten. Dazu gehört auch die Entsiegelung von Böden, damit mehr Wasser abfliessen kann.(chm)