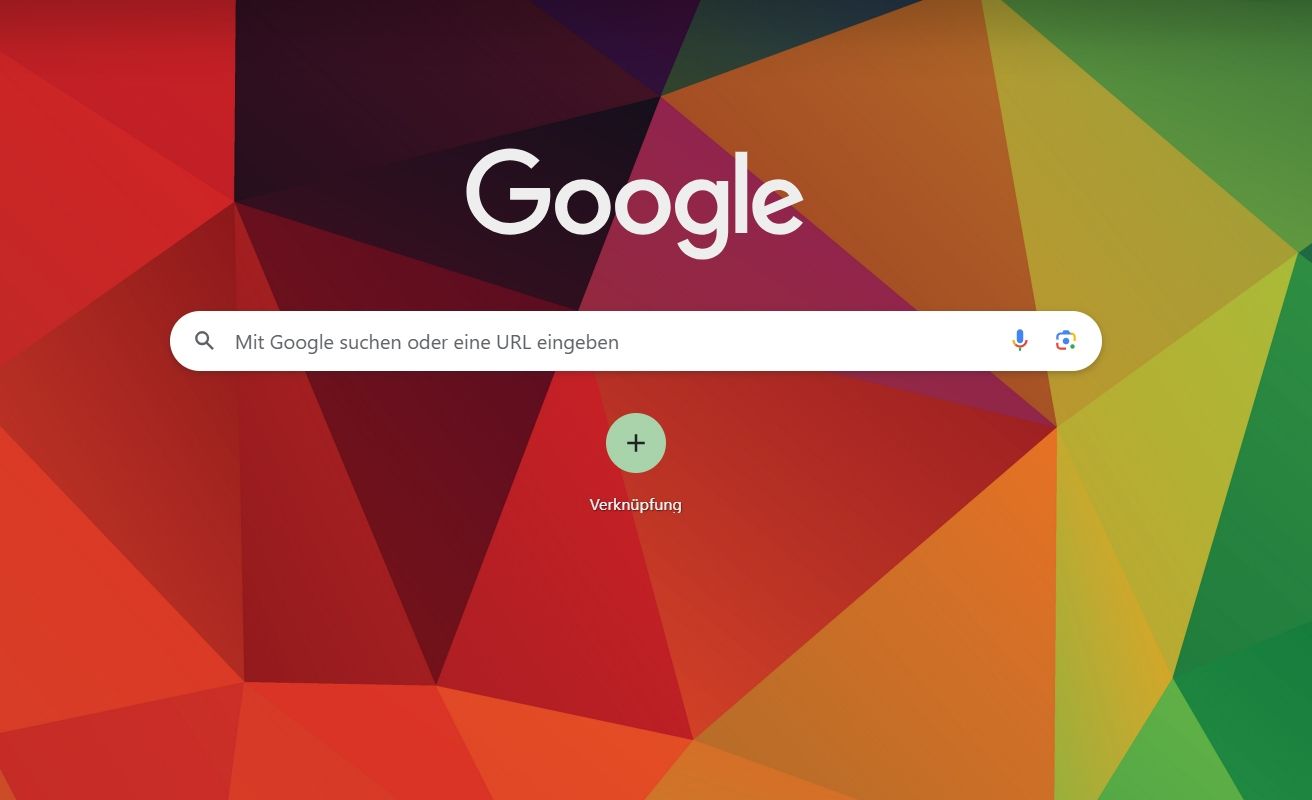Google zerstört sein eigenes Geschäftsmodell: Niemand klickt mehr auf Webseiten
Wer die Suchmaschine Google nutzt, dem wird in letzter Zeit aufgefallen sein, dass Suchanfragen von einer KI beantwortet werden. Googelt man beispielsweise die Frage «Wie finanziert sich der Vatikan?», erscheint über den gewohnten blauen Links in der Ergebnisliste eine kompakte Übersichtsdarstellung mit einer Aufschlüsselung der Einnahmequellen.
Die Google-KI «AI Overviews», die auf dem Sprachmodell Gemini basiert, durchforstet das Netz nach relevanten Informationen und erstellt eine Kurzzusammenfassung. «Google übernimmt das Googeln für Sie», sagte die Google-Managerin Liz Reid im vergangenen Jahr auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz I/O.
Viele nutzen nur Tiktok als Suchmaschine
Der Tech-Konzern reagiert damit auf die veränderten Nutzungsgewohnheiten im Netz: 40 Prozent der US-Amerikaner nutzen mittlerweile Tiktok als Suchmaschine, für die Gen Z ist die Videoplattform längst das «neue Google».
Googles Dominanz bröckelt daher: Im vierten Quartal 2024 ist der globale Marktanteil des Suchmaschinenriesen an Websuchen erstmals unter 90 Prozent gefallen. Das ist noch kein Drama, doch Analysten beunruhigt vor allem die Geschwindigkeit, mit der Google Marktanteile verliert. Ein Grund für den Abstieg ist auch nachlassende Suchqualität: Die Ergebnisliste ist voller Spam.
Google überflügelte einst die Konkurrenz von Altavista, Yahoo und Co., weil sein Pagerank-Algorithmus die Links von Webseiten analysierte und Seiten nach Relevanz gewichtete. Doch in Zeiten, in denen Sprachmodelle Informationen aus dem Internet extrahieren, gelangt dieses Prinzip an seine Grenzen. Der Nutzer muss keinen Link mehr ansteuern, sondern erhält direkt eine Antwort von der KI.
80 Prozent lesen die Originalquelle nicht mehr
«Zero-Click-Internet» nennt sich dieses Prinzip. Vorbei die Zeit, als der digitale Flaneur munter von Website zu Website surfte. Das, was Google einst zur Grundlage seines mächtigen Suchmonopols machte, zerschiesst nun seine KI: Wenn Google künftig selbst googelt und Nutzer verstärkt Chatbots konsultieren, wird dies die Mechanik des Internets massiv verändern. Laut einer Analyse der Unternehmensberatung Bain & Company greifen mittlerweile 80 Prozent der Internetnutzer auf «Null-Klick-Ergebnisse» zurück, sie lesen also die Originalquelle nicht mehr.
Das hat dramatische Folgen für digitale Geschäftsmodelle, die auf den Webtraffic von Google angewiesen sind. Geschäfte wie Bars, Restaurants oder Floristen, die aktuell noch viel Geld für Suchmaschinenoptimierung und Werbung an Google bezahlen, um in der Suchmaschine sichtbar zu sein, bangen um ihre Existenz. Denn wer sagt, dass sie in der Antwort eines Sprachmodells angezeigt werden, wenn Nutzer die KI nach einem Restaurant in der Nähe fragen?
Diesen digitalen Strukturwandel bekommen auch Verlage zu spüren. Die «Huffington Post» verlor seit der Einführung von «AI Overviews» mehr als die Hälfte ihrer Besucher, das Portal «Business Insider» musste 21 Prozent seiner Belegschaft entlassen, weil der Webtraffic einbrach.
Wenn bald KI-Agenten im Web browsen und eigenständig Tische im Restaurant reservieren und online einkaufen, könnte der Traffic weiter sinken. Denn virtuelle Agenten, die keine Emotionen haben, sind Werbegelder und visuelle Reize egal. Die Suchmaschinenoptimierung hat ausgedient.
Google ist kein Verkehrsknotenpunkt mehr
Wenn das Internet eine Megacity ist, dann war Google so etwas wie ein Haupt- und Busbahnhof, ein Verkehrsknotenpunkt, wo alle Züge und Busse starteten. Die Plattform führte den Websitebetreibern verlässlich Besucherströme zu: Der Nutzer bekam viel Reklame auf der Fahrt, wurde aber verlässlich zu seinem Ziel kutschiert. Ein wenig wie bei einer Kaffeefahrt.
Doch schon in den 2010er-Jahren änderte sich die Streckenführung im globalen elektronischen Dorf, als Google, Facebook und Co. mit ihren Apps eigene Ökosysteme und virtuelle Shoppingmalls hochzogen. Die Links wurden gekappt, die Blogs, die Cafés der digitalen Welt, starben aus. Das Internet sei kaputt, diagnostizierten Kritiker.
Doch jetzt, wo künstliche Intelligenz die Hyperlinkstruktur endgültig zertrümmert, werden Tech-Konzerne zu Abbruchunternehmen des Internets: Die Tech-Giganten zerlegen die Websites in ihre einzelnen Bausteine und trainieren damit ihre KI-Systeme. Zurück bleiben digitale Bleiwüsten, Websites, die kaum noch jemand ansteuert. Das Internet fungiert nur noch als Rohstofflager, als eine Art Umspannwerk der Tech-Industrie, wo Daten durchgeleitet werden. Damit stirbt nicht nur das Business, sondern auch die Idee des Internets als Cyberagora – einem Forum, wo die Kraft des besseren Arguments gilt.
Maschinencontent dominiert das Netz
Die KI-Systeme müllen den Cyberspace mit minderwertiger Ramschware voll: Amazon wird mit KI-generierter Schrottliteratur geflutet, auf Facebook gehen bizarre Fakes viral, auf Spotify streamen Bots botgenerierte Musik. Die Maschinen geben im Netz den Ton an – der Mensch spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Die geistige Landschaft verödet, das Internet wirkt zwischen all den Bots und automatisierten Bildfabriken seltsam entseelt.
Medienhäuser wie die «New York Times», der «Guardian» sowie CNN haben mittlerweile ihre Archive für Webcrawler gesperrt, damit sich Softwareschmieden wie OpenAI nicht mehr wie an einem Steinbruch kostenlos an ihrem geistigen Eigentum bedienen können.
Die Folge: Die Datenquellen im Netz versiegen, und die KI-Systeme kannibalisieren sich selbst, indem sie das wiederkäuen, was andere vorher ausgespuckt haben. «KI zerstört das alte Web, und das neue Web hat Mühe, geboren zu werden», schrieb der Tech-Journalist James Vincent bereits im Jahr 2023, als ChatGPT gerade ein paar Monate alt war.
Vielleicht erleben wir gerade die letzten Tage des Internets, eine Übergangsphase, in der das, was an die Stelle des World Wide Web treten soll, noch nicht klar ist. Der Google-Ingenieur und Futurist Ray Kurzweil hatte vor einigen Jahren die Vision, einen «kybernetischen Freund» zu bauen, der die Nutzer besser kennt als diese sich selbst.
Dieser virtuelle Agent würde Fragen beantworten, ohne dass man explizit danach fragt. Man müsste sich noch nicht einmal die Mühe machen, einen Prompt zu formulieren. Aber vielleicht soll der Google-Nutzer in Zukunft auch gar keine kritischen Fragen mehr stellen.