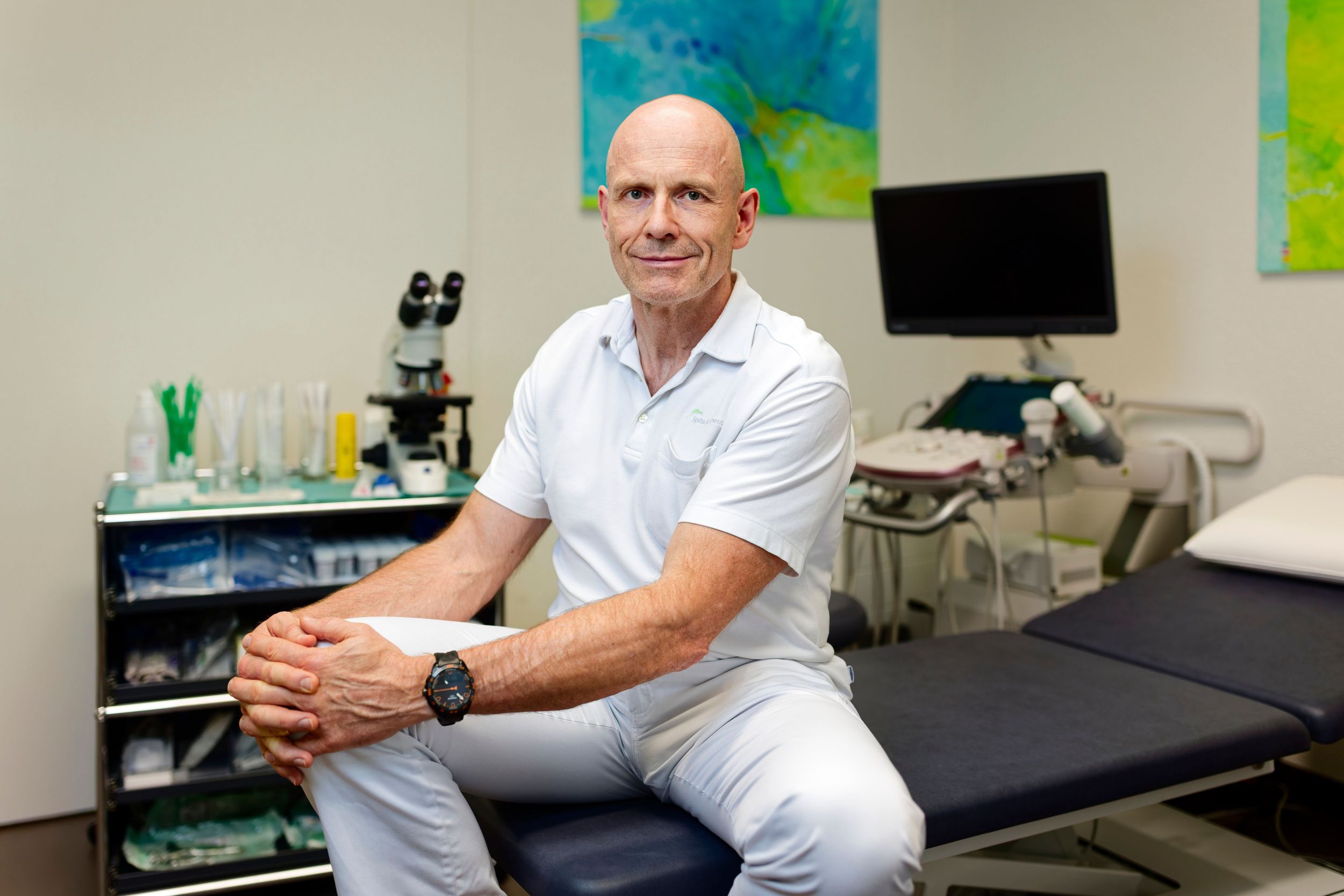
«800’000 Franken sind mehr als genug»: Dieser Arzt kritisiert zu hohe Ärztelöhne
Nach jahrzehntelangen Verhandlungen wird in der Schweiz im Januar ein neues Tarifsystem für ambulante Leistungen eingeführt. Die Branche feiert sich dafür selbst, der Versichererverband Santésuisse spricht gar von einer auszeichnungswürdigen Leistung.
Gleichzeitig führt der Bundesrat mit dem neuen System auch einen indirekten Kostendeckel für die nächsten Jahre ein. Man könnte also genau so gut sagen: Das war die absolute Notbremse, um die Kosten irgendwie in den Griff zu bekommen. Dafür gebe es allerdings noch viel zu tun, sagt der Gynäkologe und Standespolitiker Thomas Eggimann.
Thomas Eggimann, Sie verfolgen die Tarifverhandlungen in der Schweiz seit zehn Jahren. Kann man hier wirklich von einem Fortschritt sprechen?
Auf jeden Fall. Vielen ist nicht bewusst, wie polarisiert die Branche in Tariffragen lange war. Da kämpften die Ärzte gegen die Krankenkassen, die Krankenkassen gegen den Staat, und der Staat ohnehin gegen alle. Nach ewigen Diskussionen trat man vier Jahre lang nur noch auf der Stelle. Dass der Tarif nun genehmigt wurde und tatsächlich umgesetzt wird, ist schon ein Durchbruch, wenn auch ein erzwungener.
Der Bundesrat musste erst mit einem amtlichen Tarif drohen, damit sich die Ärzte und Versicherer endlich einigen konnten.
Davor haben alle Angst wie der Teufel vor dem Weihwasser: Dass der Staat einen Tarif festlegt, in dem niemand mehr mitreden kann. Das hat schon auch dazu beigetragen, dass man einsichtig wurde. Nun ist klar, dass nicht alle mehr verdienen können, wenn das System gleichzeitig billiger werden soll.
Das klingt banal. Hätte das nicht von Anfang an allen bewusst sein können?
Ich denke schon, dass es klar war. Gleichzeitig muss man sehen: Die Tarife im ambulanten Bereich haben sich seit 2004 nicht nennenswert verändert. In dieser Zeit hatten auch die Ärzte nie einen Teuerungsausgleich. Unter dem Strich verdient ein Arzt deshalb heute weniger Geld, als er noch vor zwanzig Jahren verdient hätte. Dass dann alle versuchen, für sich noch das meiste herauszuholen, ist klar. Aber irgendwann musste man eben einen Kompromiss finden.
Zur Person
Thomas Eggimann ist seit 2004 als Gynäkologe und leitender Arzt in verschiedenen Kliniken und Spitälern sowie als Standespolitiker tätig. Er führte acht Jahre lang eine eigene Praxis und ist nun stellvertretender Leiter der Gynäkologie im Spital Emmental in Burgdorf. Seit 2015 ist Eggimann auch Generalsekretär der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und nimmt in dieser Funktion an Debatten rund um die Sicherung der Qualität in der Schweizer Medizin sowie zu Kostendiskussionen teil. Eggimann ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder.
Schon jetzt ist der Widerstand gegen den Tarif – trotz der langen Verhandlungen – gross. Erste Fachgesellschaften, auch die Gynäkologen und Radiologen, haben angekündigt, dass man auf gewisse Untersuchungen werde verzichten müssen, weil sie nicht rentierten. Stimmt das?
Das halte ich für unwahrscheinlich. Es tut natürlich weh, wenn man für Mammografien auf einmal deutlich weniger verrechnen kann als im Vorjahr. Gleichzeitig denke ich schon, dass uns gewisse Hemmungen abhandengekommen sind.
Inwiefern?
Wir haben heute Radiologie-Institute, in denen die Geräte Tag und Nacht laufen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da stellte sich die Frage, ob es an der Insel wirklich ein zweites MRI für die Schweiz brauche! Heute «tschädderet» man die Leute einfach durch diese Geräte. Nach den Kosten fragt niemand.
Das wollen die Patienten aber oft auch selbst.
Natürlich. Die Bevölkerung ist gewachsen, sie ist älter geworden – und dadurch nicht gesünder. Die Ansprüche sind gestiegen. Wem heute das Knie schmerzt, der will morgen ein MRI. Aber die Schuld an den höheren Kosten kann man nicht nur den Patientinnen und Patienten in die Schuhe schieben.
Sondern?
Es gibt zu viele Anreize, das System teurer zu machen. Bei uns gilt immer noch «pay for performance»: Wer mehr macht, verdient mehr. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass Prävention in der Schweiz relativ schlecht läuft und noch schlechter bezahlt wird. Dabei wäre die beste Operation die, die wir gar nicht durchführen müssen. Und dann müssten wir schon auch noch einmal über die Ärztelöhne reden.
Schiessen Sie los.
Es gibt Kollegen, die verdienen über eine Million pro Jahr. Das sind natürlich Einzelfälle. Aber das ist sehr viel Geld für Leistungen, zu denen es wenig Alternativen gibt. Wenn die UBS Sergio Ermotti 20 Millionen zahlt und ich damit nicht einverstanden bin, dann kann ich zu einer anderen Bank wechseln. Aber das Gesundheitswesen wird, mit Ausnahme des Selbstzahlerbereichs, alles über Steuergelder und Kopfprämien bezahlt. Da zahlen wir alle dran!
Die hohen Löhne sind aber auch an vieles gekoppelt: lange Arbeitszeiten, Nacht- und Pikettdienste, die Verantwortung für das Leben anderer Menschen.
Das stimmt. Aber es gibt viele andere Menschen, die auch einen strengen Job haben. Eine Kassiererin in einem Supermarkt in einer Bahnhofsunterführung zum Beispiel: Die ist den ganzen Tag unglaublich vielen Reizen ausgesetzt, ohne Tageslicht, mit langen Arbeitszeiten und unglaublich viel Stress. Und die verdient einen Bruchteil dessen, was wir monatlich bekommen.
Wie viel sollte ein Arzt denn maximal verdienen dürfen?
Das will ich niemandem vorschreiben. Aber es muss keine Million sein, wirklich nicht. Das kann man mit guter Medizin auch nicht verdienen. Natürlich sieht man bei diesen Löhnen einen grossen Verlust, wenn man ein Fünftel weniger verrechnen darf. Aber 800’000 Franken sind immer noch mehr als genug.
Mit solchen Aussagen machen Sie sich wenig Freunde.
Es gibt durchaus ein paar Schlüsselstellen, Ärzte, die für eine ganze Gesundheitsregion die schwierigsten und komplexesten Fälle übernehmen. Diese Arbeit hat ihren Preis, der darf auch etwas höher sein. Aber davon gibt es in der Schweiz in meinem Fach nicht mehr als ein Dutzend. Ein Kollege hat einmal gesagt: In der Schweiz gibt es wohl nicht zu wenig Ärzte. Diejenigen, die es gibt, machen aber zu viel.
Streiten Sie gerade ab, dass es einen Ärztemangel gibt?
In der Peripherie gibt es diesen Mangel schon, und dort verschärft er sich auch. Dafür gehen in den Städten ständig neue Praxen auf. Und die haben alle offenbar genug zu tun. Da gibt es schon auch Sparpotenzial.
Zum Beispiel?
Ich habe Patientinnen, die alle drei Monate zu einem Brust-Ultraschall aufgeboten wurden, nur für den Fall, dass es doch noch einen Krebs gäbe. Das ist völlig unnötig.
Solche Leistungen wären mit den neuen Pauschalen teilweise defizitär. Reicht das schon aus, um die Höchstlöhne zu senken?
Klar, damit hat man etwas über das Ziel hinausgeschossen. Aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sich das einpendelt. Hunger wird deswegen niemand leiden. Auch die Radiologen und Gynäkologen können damit noch gut leben.
Braucht es einen Lohndeckel?
In den Spitälern wurde schon vieles unterbunden. Da sind die Löhne heute meist nach kantonalen Vorgaben und Lohnsystemen geregelt und auch gedeckelt. Da wird sich auch mit den neuen Tarifen wenig ändern.
In den selbstständigen Praxen sind die Löhne deutlich höher.
Das stimmt. Aber insgesamt sind die Fälle, die Aufsehen erregen, die Ausnahme. Und in die Gesundheitskosten fliesst viel mehr ein: Material- und Medikamentenpreise zum Beispiel. Noch wenn jeder Arzt nur halb so viel verdienen würde wie heute, hätte das höchstens eine kurze Abflachung der Kosten zur Folge. Aber damit wäre noch nichts gerettet.
Es gibt auch andere Möglichkeiten, die Kosten einzuschränken – zum Beispiel, indem in einzelnen Fachgebieten keine neuen Ärzte mehr zugelassen werden. Was bringt das?
Es gibt tatsächlich Spezialistengruppen, aus welchen mir Kollegen gesagt haben, es gebe tatsächlich zu viele Ärzte aus demselben Gebiet in der Region. Die würden einen Zulassungsstopp begrüssen. Aber die Frage ist natürlich, wie man diesen Cut macht. Und vielleicht ergibt sich das auch ganz von selbst, wenn im Inland kein Nachwuchs mehr folgt. Es braucht eine sehr sorgfältig geführte Bedarfsanalyse – sonst sind die Folgen verheerend.
Man könnte auch den Vertragszwang lockern: Damit könnten die Krankenkassen entscheiden, mit welchen Ärzten sie zusammenarbeiten wollen. Diese Lockerung steht schon seit zwanzig Jahren im Raum. Warum wurde sie immer noch nicht eingeführt?
Weil die Folgen solcher Einschränkungen schwierig sind. An sich wäre das vielleicht eine gute Idee. Aber die Frage ist schon, welche Ärzte dann übrig bleiben. Lässt man dann nur noch die billigsten Ärzte zu? Vielleicht hat ein anderer einfach die komplexeren Fälle. Je nach Vorgabe kann eine Begrenzung auch zu einem Preiskampf nach unten führen. Das wäre wiederum nicht im Sinn der Patienten.
Also müssen wir hohe Ärztelöhne weiterhin in Kauf nehmen.
Wir haben nach wie vor ein teures, aber gutes Gesundheitssystem, das den hohen Ansprüchen im Moment auch gerecht werden kann. Zum Vergleich: In Grossbritannien kriegen Sie ab 70 Jahren keine Hüftprothesen mehr. Bei uns kriegen Sie die noch mit 80 Jahren. Und können dann noch Sport machen. Das können wir auch aufrechterhalten, und das darf auch etwas wert sein. Was wir einschränken müssten, sind diese Überflieger-Einkommen. Mich irritieren die Ärzte, die sich an diesem System bereichern.
Gerade die Fachbereiche mit den hohen Löhnen klagen am lautesten über die neuen Tarife. Einige haben schon Änderungswünsche angemeldet, die in den nächsten Jahren geprüft werden sollen. Kann es so wirklich Fortschritte geben?
Ich denke schon, dass der Druck von Bundesrat und Politik hier etwas bringt. Er hat eine neue Dynamik angestossen.
Inwiefern?
Früher gab es auch unter den Ärzten viele Feindschaften, vor allem zwischen den Spezialisten und der Grundversorgung. Das scheint sich jetzt zu ändern. Man nimmt gerade mit den neuen Pauschalen wirklich Nachteile für die Spezialisten in Kauf, um zu einer Lösung zu kommen. Und umgekehrt haben auch die Hausärzte eingesehen, dass es uns Spezialisten braucht.
Auch da könnte man sagen: Das hätte allen klar sein können.
Natürlich. Und gleichzeitig gehen immer wieder Dinge unter. Kürzlich wurde ich zum Beispiel zu einer Projektbesprechung eingeladen, die haben Befragungen mit den Kantonen, den Ärzten und der Bevölkerung durchgeführt. Aber die Bundespolitik hatte man vergessen. Jetzt habe ich den Eindruck, dass allen bewusster wird, dass wir die Kosten nur gemeinsam in den Griff kriegen. Eben auch, weil die Leute gemerkt haben, dass es sonst in ein rein staatliches System kippen könnte. Und das will niemand.
Warum?
Weil es weiter weg vom Patienten ist. Solche Strukturen gibt es in anderen Ländern, etwa in Kuba. Aber die Strukturen sind unglaublich starr und ausschliessend, und auch relativ teuer.
Andererseits: Günstiger wird das System auch bei uns nicht.
Die Gesundheitskosten werden nicht mehr sinken. Das ist schon rein demografisch unmöglich. Aber wenn die Wachstumskurve pro Patient und Jahr mittelfristig leicht abflachen würde, wäre das schon viel wert.
Wie schaffen wir das?
Wenn ich das wüsste, wären wir wohl nicht hier. Aber wenn etwas geschehen soll, wird es nur gemeinsam gehen. Das haben auch die Versicherer eingesehen. Es gibt auch dort viele Modelle und Ideen, die salonfähig werden – zum Beispiel eine Einheitskasse in der Grundversorgung. Uns stehen noch einige Systemwechsel bevor. Bis zum nächsten wird es aber nicht nochmals zwanzig Jahre dauern. Davon bin ich überzeugt.





