
Fuckability, Feminismus, Frust: Ein Roman, der das Patriarchat aufbricht
Man, beziehungsweise wohl vor allem Mann, muss hier stolpern. Also beim Lesefluss ins Stocken geraten. Konventionen vergessen. Gewohnheiten hinterfragen. Ärger erleben, ertragen, überwinden. Die österreichische Autorin Marlene Streeruwitz geht ähnlich wie Elfriede Jelinek radikal an die Literatur heran. Dies nicht nur mit der äusserst subjektiven Sicht einer hoch empfindsamen, weiblichen Romanfigur.
Solches findet sich ja auch in vielen anderen Gegenwartsromanen. Einzigartig ist auch im neuen Roman «Auflösungen» insbesondere ihr Kurzsatz-Stil: «Sich frei bewegen. Sich frei bewegen in so einem Text. Frei sein. Und deshalb. Ja? Gerade deshalb einander. Also. Erkennen? Sie nahm einen grossen Schluck Kaffee.»
Das liest sich zwar wie eine schlichte, holprige Assoziationsreihe mit vielen Auslassungen – Gedanken über Literatur und Liebe. Bei Streeruwitz hat dieser Stil jedoch zusätzlich einen programmatischen Zweck: Literarische Sprache soll die gedanklichen und emotionalen Gewohnheiten der Lesenden hartnäckig stören.
In einer Poetik-Vorlesung hat sie es so erklärt: «Die Ablehnung grammatikalischer Geordnetheit in meinen Texten ist die Ablehnung der Weltverhältnisse, so wie sie sind. Der ganze Satz nur der Beschreibung einer Ansicht oder eines Vorgangs legt diese Ansicht und diesen Vorgang als unveränderlich so gewollt fest.» Dass ihre Satzzerstückelung sperrig wirkt und nervig sein kann, nimmt sie lächelnd in Kauf. Denn letztlich geht es bei Streeruwitz immer darum, patriarchale Ordnungen zu durchdringen, sprachlich zu zersetzen – und gelegentlich subversiv statt des «man» ein «eine» zu platzieren.
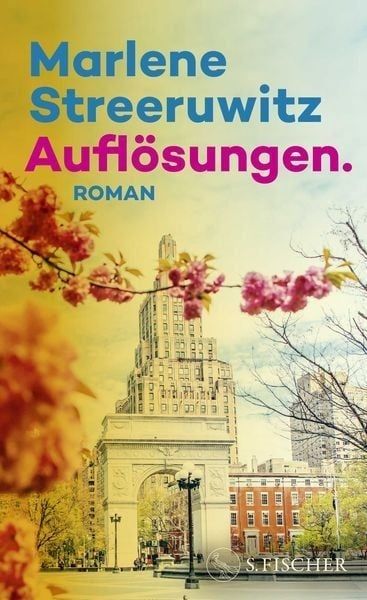
Bild: S. Fischer
Anhand verstörter Menschen zeichnet sie ein Seelenporträt von New York
Die Menschlichkeit liegt am Boden. So beginnt Streeruwitz’ neuer Roman. Es ist das Sinnbild für Ninas Blick auf das gegenwärtige New York. Nina, die Hauptfigur in «Auflösungen», Wiener Lyrikerin, unglücklich geschieden, verbittert, reist zu einer Gastdozentur nach New York – um sich von der Wiener Altlast zu befreien. Was ihr natürlich nicht gelingt. Am Flughafen sieht sie eine Frau bewegungslos vor der Passkontrolle am Boden liegen. Nina ist erschüttert, reagiert angesichts der rigiden Einwanderungspolitik hilflos, eingeschüchtert wie alle Umstehenden.
Nina erlebt ein von Obdachlosen gepflastertes, für die Kulturbohème unbezahlbar gewordenes und Palästina-Demonstrationen brutal unterdrückendes New York. Streeruwitz gelingt neben Ninas Ohnmacht auch ein New Yorker Seelenporträt anhand verstörter Menschen. Die durchgängig tagebuchartig detaillierten Schilderungen dieses heruntergekommenen New York haben eine unerhörte Sogwirkung.
Ninas alte New Yorker Freunde sind in der Nach-Corona-Zeit immer noch depressiv, desillusioniert, erschöpft. Einzig ihre lesbischen Nachbarinnen sind voller pragmatischer Lebenszugewandtheit und Empathie. Diese werden am Ende von Ninas New Yorker Odyssee auch zu Retterinnen – was dem Roman eine für Streeruwitz’ Werk überraschende, solidarische Helligkeit schenkt.
Die Sackgasse des verinnerlichten Patriarchats
Wie ist das nun mit dem Patriarchat? Nina verkörpert exemplarisch die Sackgasse eines verinnerlichten Patriarchats, aus dem sie keinen Ausweg findet. Sie betrachtet ihre mit Mitte 50 verschwundene sexuelle Attraktivität, ihre «Fuckability», als Hauptkriterium weiblicher Identität, kommt vom patriarchalen Rollenverständnis nicht los.
Sie klebt im Selbstmitleid und in ihrer Opferrolle fest, sehnt sich nach ihrem neuen, herzlosen Liebhaber, der sich nach der ersten Liebesnacht nicht mehr gemeldet hat, sieht in ihrem Ex-Mann einen Verräter, der ihr die Tochter entrissen hat – und dokumentiert damit ihre Gefangenschaft in einem toxischen Bewusstsein. Emanzipation? Eine Illusion. In ihrem «Handbuch für die Liebe» hat Streeruwitz es so formuliert: «Vernachlässigung wendet sich am Ende in schuldbeladene Selbstverachtung», was die «kulturelle Grundlage» unserer Gegenwart sei. So gelesen ist auch «Auflösungen» ein brutaler, pessimistischer Roman.
Streeruwitz hat eine besondere Fähigkeit, gesellschaftliches Unwohlsein und politische Traumata in der psychischen Bedrängtheit ihrer weiblichen Romanfiguren zu spiegeln. Sozialer Druck schlägt sich oft körperlich nieder. Darin steckt viel Sigmund Freud und Karl Marx: Das sexuelle Begehren definiert die Knechtschaft des Menschen, und das gesellschaftliche Sein prägt das Bewusstsein. Man mag dies pessimistisch und gestrig finden. Aber darin steckt wohl eine tiefe Wahrheit: dass die Menschen ihre Traumata einfach nicht abschütteln können – egal, wohin sie auch zu fliehen versuchen.





