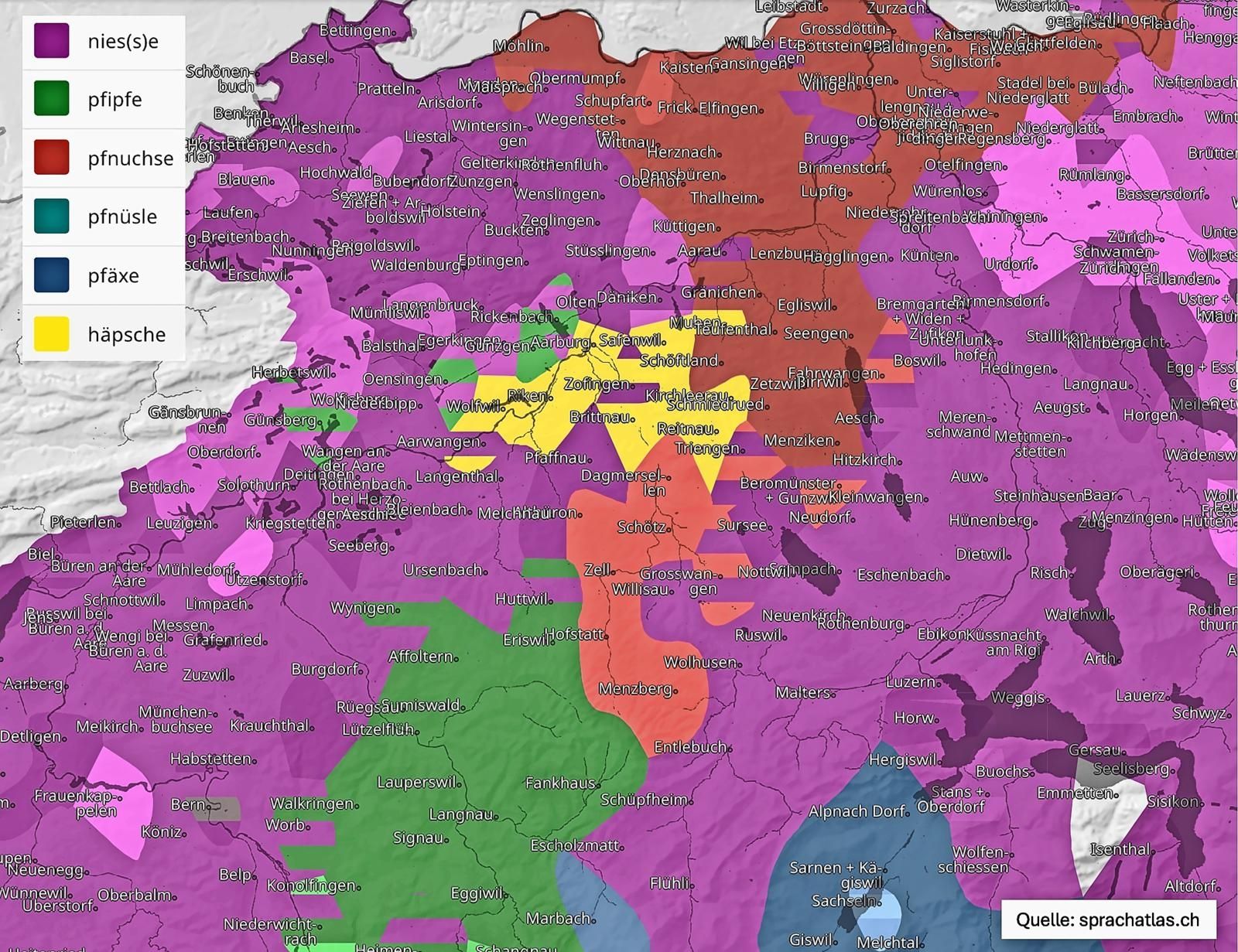«Ade, Merci» auf dem Land, Schweigen in der Stadt
Fährt man mit den A-Welle-Bussen in Zofingen, kennt man die Szene: Die Tür geht auf, man steigt aus – manchmal begleitet von einem «Ade» oder «Merci» zum Fahrer, manchmal ganz ohne Worte. Und wer sich mit Sprachgewohnheiten beschäftigt, weiss: Gerade solche kleinen, nebensächlichen Rituale folgen oft einem grösseren Muster.
In der Schweiz spricht man in diesem Zusammenhang von der «Grüezi-Grenze» zwischen Stadt und Land: Auf dem Land grüsst man sich noch selbstverständlich, in der Stadt hingegen deutlich weniger. Uns interessierte, ob sich dieses Muster auch im Bus zeigt. Wird auf dem Land häufiger gegrüsst und gedankt als in der Stadt? Um das herauszufinden, haben wir das Verhalten von Fahrgästen genauer untersucht. Solche Gesten sind mehr als Routine – sie zeigen, wie Menschen im Alltag miteinander umgehen. Gerade für eine Region wie Zofingen, die irgendwo zwischen städtischer Anonymität und ländlicher Nähe liegt, ist das besonders interessant.
Rund ein Viertel der Landbevölkerung sagte «Merci» – hingegen in der Stadt keine einzige Person.
Um dieser Frage nachzugehen haben wir 236 Buspassagiere direkt beobachtet – von Berns Innenstadt bis ins Berner Oberland. Unsere Beobachtungen machen Unterschiede klar sichtbar: In der Stadt Bern sagten beim Aussteigen gerade einmal zwei Prozent der Fahrgäste «Ade». Auf dem Land dagegen war es mehr als die Hälfte. Und beim Danken fiel das Bild noch deutlicher aus: Rund ein Viertel der Landbevölkerung sagte «Merci» – hingegen in der Stadt keine einzige Person.
Die Daten zeigen weiter: Alter, Ausstiegstür und Anzahl der Leute spielen eine wichtige Rolle. Wer vorne beim Chauffeur hinausgeht, sagt deutlich häufiger «Merci» als jemand, der hinten verschwindet. Ältere Fahrgäste verabschieden sich öfter als jüngere. Und wer alleine aussteigt, gibt eher ein «Ade» von sich, als wenn gleich mehrere Leute gleichzeitig den Bus verlassen. In der Forschung heisst dieses Phänomen «Verantwortungsdiffusion»: Je mehr Leute gleichzeitig etwas tun könnten, desto weniger fühlt sich der Einzelne zuständig – auf den Bus bezogen heisst das: «Sollen doch die anderen ‹Merci› sagen.»
Warum sind die Stadt-Land-Unterschiede so deutlich? Ein Grund liegt sicher in der Nähe zwischen Fahrgästen und Fahrpersonal. Auf dem Land kennt man den Fahrer häufiger. Man fährt längere Strecken, die Route führt vielleicht über schmale Strassen – gerade im Oberland oft kurvig und im Winter verschneit. Da entsteht fast automatisch ein Gefühl von «Wir sitzen im gleichen Boot» (bzw. Bus) – und wenn man heil ankommt, ist ein «Merci» mehr als eine Floskel, sondern vielleicht sogar Ausdruck echter Erleichterung (haha).
In der Stadt ist die Situation anders: Hier wechseln die Fahrer öfter, der Bus fährt alle paar Minuten, und die Fahrt ist meist kurz. Man steigt ein, fährt zwei, drei Haltestellen, steigt wieder aus. Hinzu kommt die Anonymität: Kaum jemand kennt den Fahrer, kaum jemand die Mitreisenden. Für viele ist der Bus nur ein Mittel zum Zweck. Entsprechend denkt man beim Aussteigen eher an die nächste Verbindung, die man noch erwischen möchte, als daran, noch schnell «Ade» zu rufen.