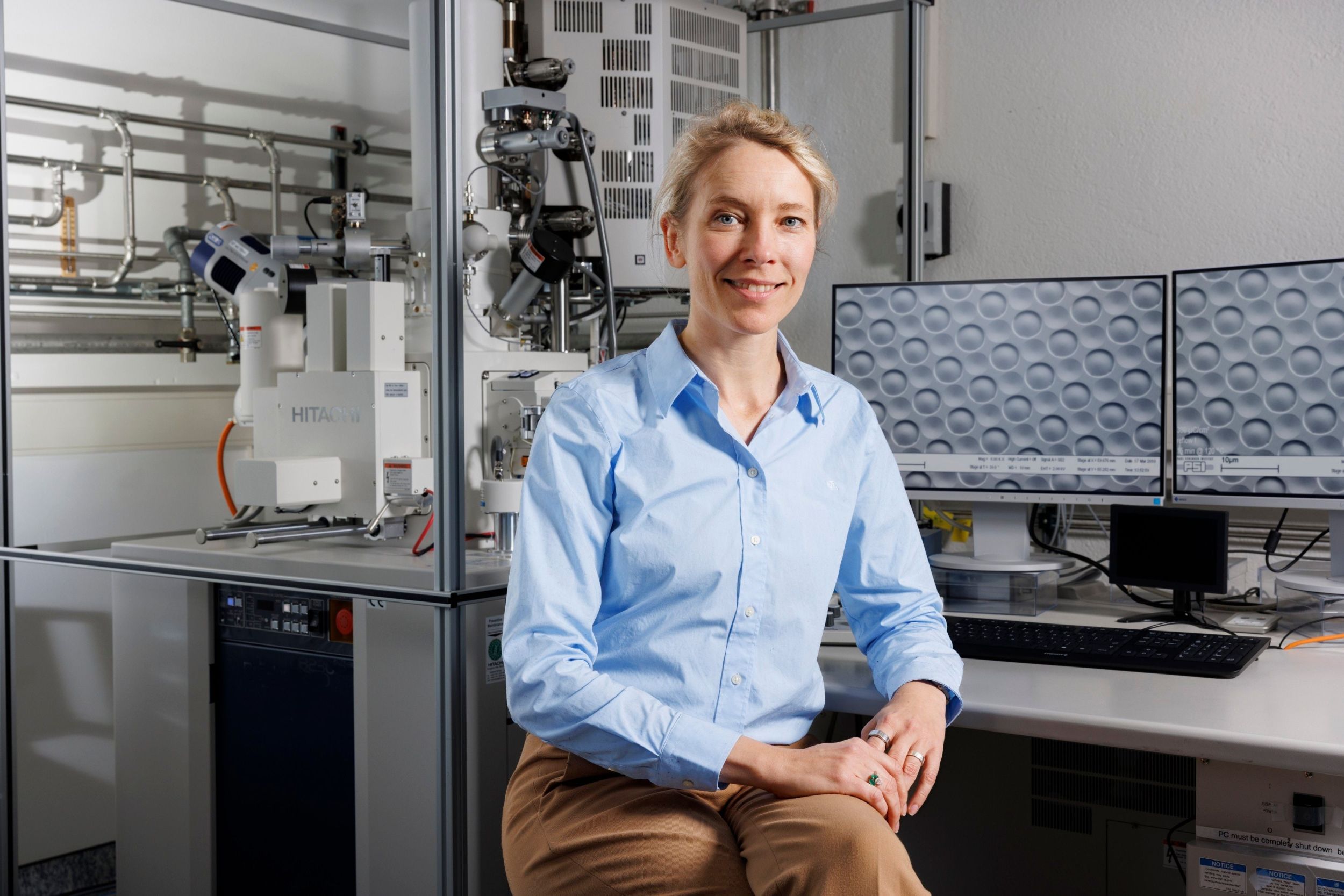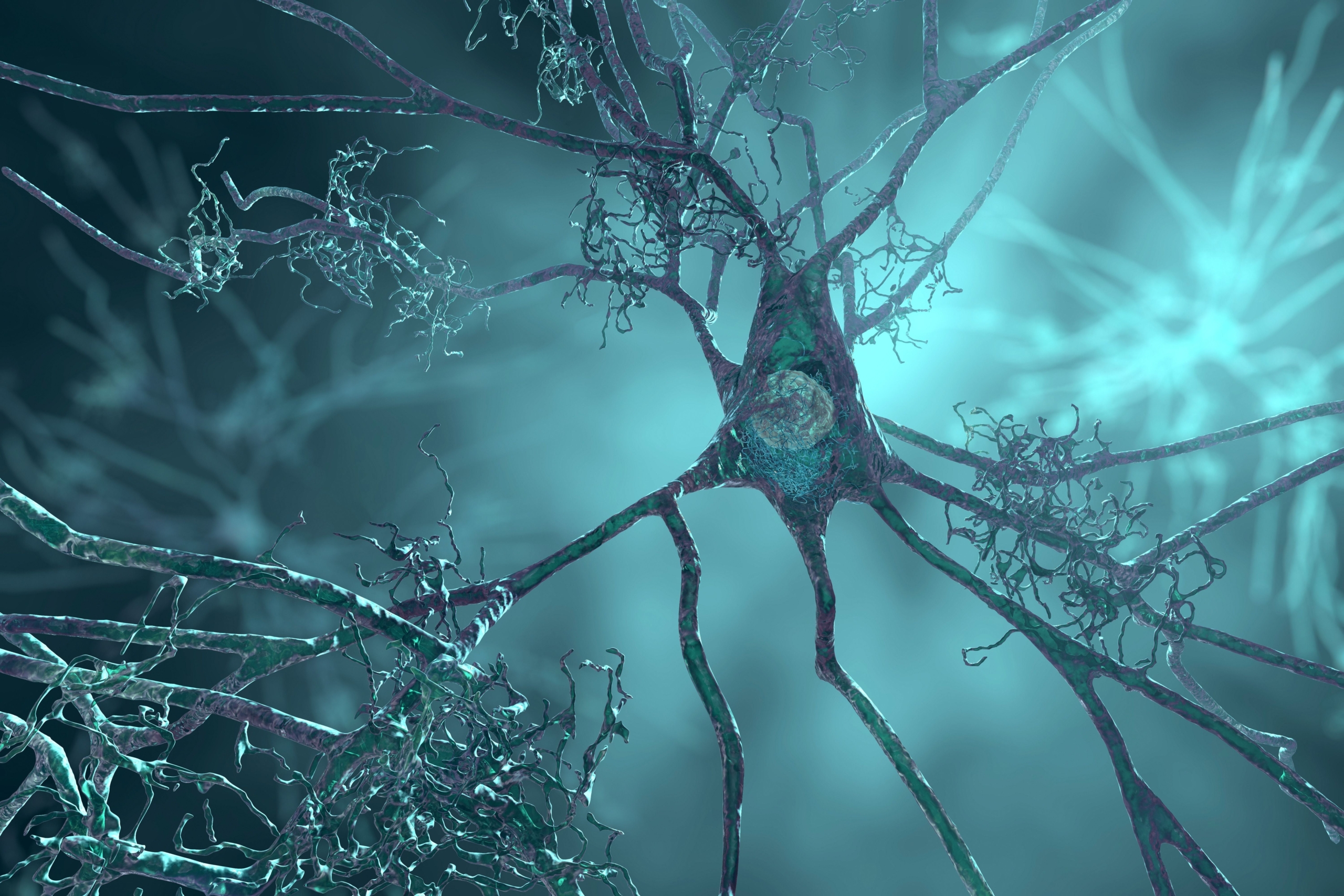
Alzheimerskandal: Um Fälschungen zu verhindern, müssen Studien mit negativen Resultaten mehr Gewicht erhalten
Star-Neurowissenschafter Sylvain Lesné war nur 32 Jahre alt, als er seine vielzitierte Studie zur Entstehung von Alzheimer veröffentlichte. Die Arbeit löste auf einen Schlag fast alle seine Probleme. Eine Ausweisung aus den USA, wo er damals forschte, war vom Tisch. Einen neuen Starforscher schmeisst schliesslich kein Land raus. Nach seiner Publikation im Topjournal «Nature» erhielt er schon bald ein eigenes Labor mit Angestellten. Besseres Salär und Forschungsgelder in Millionenhöhe folgten in den darauffolgenden Jahren.
Bloss: Die Studie war mutmasslich gefälscht, wie sich nun gut 15 Jahre später zeigt. So weit gehen wie Lesné, würden wohl die wenigsten Wissenschafter gehen. Doch die Verlockung ist heute gross, Forschungsarbeiten mit zumindest fragwürdigen Methoden zu beschönigen, um am Schluss ein positives Resultat vorweisen zu können. Das zeigt auch die Kontroverse um Studien zu elektrischer Hirnstimulation, die Alzheimerkranken so verkauft werden, dass sie Hoffnung auf Besserung machen. Ohne dass heute klar ist, ob Hirnstimulation den Patienten überhaupt je etwas bringen wird.
Denn von der Konklusion der Studie hängt ab, ob sie in einem der angesehenen Journals publiziert werden kann oder nicht. Ob sie sorgfältig gemacht wurde und beispielsweise wegen einer sehr grossen Teilnehmerzahl eigentlich eine fundierte wissenschaftliche Grundlage hat, ist dagegen oft nebensächlich.
Das Problem wurde unter dem Stichwort «Publikationsbias» auch schon wissenschaftlich untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass in Fachjournals immer mehr Erfolgsmeldungen veröffentlicht werden. Waren es im Jahr 1990 erst etwa 70% positive Studien, sind es im Jahr 2007 bereits über 85%. Schaut man sich die letzten drei Ausgaben vom einflussreichen «Lancet» an, findet man ausschliesslich erfolgreiche neue Medikamente, kein einziger Artikel fand heraus, dass die geprüfte Intervention nichts brachte.
Dabei liessen sich komplexe Forschungsfragen nur verlässlich klären, wenn die Untersucher nicht unter Druck stünden, etwas Positives zu präsentieren. Solange Topjournals nicht auch Studien mit negativen Resultaten das Gewicht zusprechen, das sie aufgrund der Sorgfalt ihrer Methodik verdienen, bleibt der Druck auf die einzelne Wissenschafterin hoch, möglichst eine grossartige Wirkung des Studienobjekts zu finden.
Negative Studienresultate sind aber keine Schande, sondern sollten im heutigen Forschungsklima sogar gefördert werden. Weil man einmal nichts findet, heisst das nicht, dass man als Forscher versagt hat. Die Suche nach der Wahrheit führt oft in die Irre, die Wissenschaft lebt vom mühsamen Pendeln zwischen Misserfolg und Erfolg. Echter Erkenntnisgewinn ist ohne das Betreten von Sackgassen nicht möglich. Es wäre deshalb nötig, dass die Forschungskultur sich zur Akzeptanz vom Nichtsfinden hin verändert.
Möglich wäre das, wenn auch die Verwalter von Forschungsgeldern etwas gegen das Problem des Publikationsbias tun. Es sollten nicht nur Projekte Unterstützung erhalten, die auf positive alte Studien in die gleiche Forschungsrichtung verweisen können. Als Beleg für die Notwendigkeit neuer Forschung müssten auch alte Studien akzeptiert werden, die nachweisen, dass ein früherer Versuch in eine ganz andere Richtung nichts Substanzielles gefunden hat. Und: Wissenschafterinnen, die auch negative Studien veröffentlichen und nicht ausschliesslich handgepickt Positive, sollten bei gleicher Ausgangslage den Vorzug erhalten.
Daneben braucht es auch eine rigorosere Überprüfung von Resultaten mit künstlicher Intelligenz. Obwohl die Programme heute bereitstehen, werden sie noch zu wenig genutzt. Es ist deshalb richtig, dass die Geldverwalter dies von den Fachzeitschriften einfordern, wie es Matthias Egger, Präsident des Schweizerischen Nationalfonds, kürzlich in dieser Zeitung getan hat. Die Welt der Wissenschaft sollte Verbesserungen in diese Richtung auch aus Eigeninteresse realisieren. Denn wenn sie sich für künstliche Erfolgsmeldungen zu weit aus dem Fenster lehnt, droht sie ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren – und damit ihren hohen Stellenwert für die Gesellschaft.