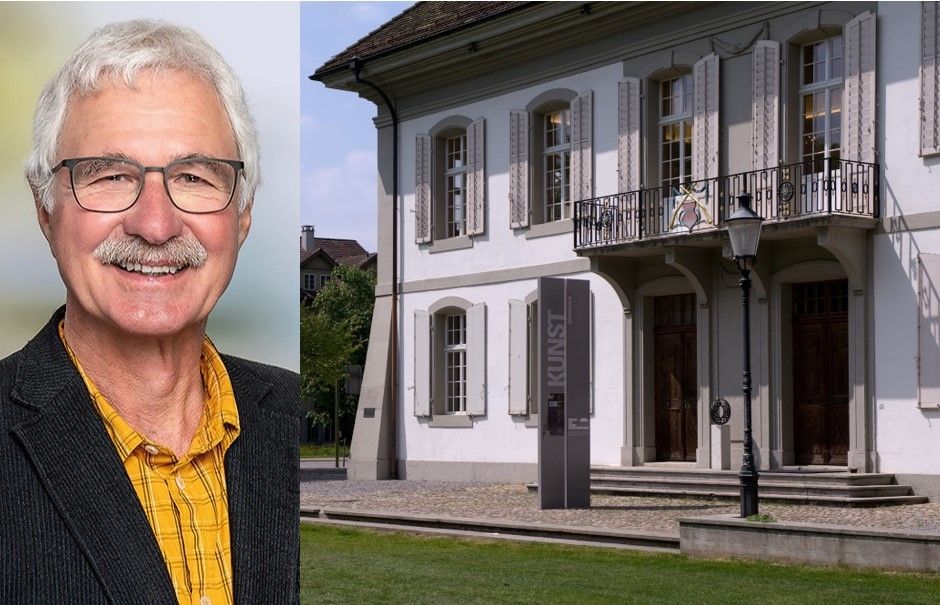«Ich will in Zofingen zu positiven Veränderungen beitragen»

Wahl-Zoff in Murgenthal? Social-Media-Kampagne pusht Vizeammann-Kandidaten als Ammann

Stadtrat will das Zofinger Abfallreglement ganz ohne Ideologie regeln

«Eine nachhaltige Finanzpolitik ist der Schlüssel für ein lebenswertes Zofingen»

Nach brutaler Prügelattacke auf ihren Präsidenten: SVP reicht Postulat für mehr Sicherheit ein

Zofingen rechnet im nächsten Jahr mit einer Nettoschuld von 19 Franken pro Einwohner
Der Steuerfuss von Zofingen bleibt auch im kommenden Jahr bei 99 Prozent. Dies zeigt das am Montag veröffentlichte Budget 2026. Trotzdem rechnet die Stadt mit rund 3 Millionen Franken mehr Steuererträgen – 45 Millionen Franken sind budgetiert. Klingeln soll die Kasse vor allem bei den Steuereinnahmen von juristischen Personen: 2,6 Millionen Franken sollen mehr eingenommen werden als noch 2025. «Dieser Zuwachs wird nach aktuellem Stand kein einmaliger Effekt sein», schreibt die Stadt. Gleichzeitig hält der Stadtrat fest, dass die beeinflussbaren Aufwandpositionen sehr zurückhaltend weiterentwickelt worden seien. Unter dem Strich rechnet die Stadt daher mit einem Ertragsüberschuss von 2,1 Millionen Franken. Das sind 1,3 Millionen Franken mehr als für 2025 budgetiert worden sind.
3,4 zusätzliche Stellen in der Verwaltung
Ein Streitpunkt bei den Ausgaben fürs kommende Jahr ist in der Budget-Sitzung des Einwohnerrats jeweils der Stellen-Etat. Fürs Jahr 2026 beantragt der Stadtrat 3,4 Vollzeitstellen zusätzlich für die Verwaltung. Davon seien 0,5 Vollzeitstellen durch Dritte finanziert und 1,1 Vollzeitstellen würden Leistungen, die sonst eingekauft werden müssten, reduzieren, legt der Stadtrat dar. Von den zusätzlichen Stellen profitieren sollen die Bereiche Präsidiales, Finanzen, Hochbau, Werkhof sowie Kultur und Gesellschaft.
Im Bereich Präsidiales soll mit 50 Stellenprozenten eine juristische Fachperson angestellt werden, die unter anderem die Überarbeitung von Reglementen begleitet. 50 Stellenprozente sind fürs Regionale Betreibungsamt und die Abteilung Finanzbuchhaltung vorgesehen. Im Bereich Hochbau soll der Teilbereich Hauswartung und Reinigung gestärkt werden. Der Werkhof braucht 30 Stellenprozente in der Administration und im Bereich Kultur und Gesellschaft soll die Aufsuchende Jugendarbeit mit 60 Stellenprozenten fix verankert werden. Bisher lief die aufsuchende Jugendarbeit über ein Pilotprojekt, das der Kanton Aargau mitfinanziert hat und nun nicht mehr verlängert werden kann. Wird die neue Stelle nicht geschaffen, müssen vom Kanton bezogene Gelder im Umfang von 90’000 Franken zurückbezahlt werden. Die Stelle für die Aufsuchende Jugendarbeit könne ohne Auswirkung auf die Lohnsumme der Abteilung Gesellschaft geschaffen werden, hält der Stadtrat fest.
Selbstfinanzierung von 32,5 Prozent
In den nächsten zehn Jahren plant die Einwohnergemeinde der Stadt Zofingen (ohne Spezialfinanzierungen) Nettoinvestitionen von 95,5 Millionen Franken. 19,3 Millionen Franken sind im nächsten Jahr vorgesehen – sie können zu 32,5 Prozent (6,3 Millionen) selber finanziert werden. Der voraussichtliche Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich somit auf 13 Millionen Franken, was zu einer Nettoschuld von 0,3 Millionen Franken führt. Umgerechnet auf die 13’163 Einwohnende der Stadt Zofingen macht dies rund 19 Franken pro Kopf.
Die Hauptausgaben im nächsten Jahr konzentrieren sich aufs neue Oberstufenzentrum: 11,7 Millionen Franken sind laut Budget für den Bau des neuen Schulhauses nötig. Auch die Auslagerung des Casalegre (ehemals Seniorenzentrum) wird im Budget sichtbar. Die 2,5 Millionen Franken für das Dotationskapital werden über die Investitionsrechnung verbucht. Auf der anderen Seite dürfe im nächsten Jahr mit den 3,5 Millionen Franken des Bundes für den neuen Bahnhofplatz gerechnet werden, schreibt der Stadtrat.
Gebühren für Abwasserbeseitigung werden überprüft
Bei den Spezialfinanzierungen rechnet die Abwasserbeseitigung mit Nettoinvestitionen von 2,8 Millionen Franken. Investiert wird in Hochwasserschutz, beispielsweise beim Stadtbach, sowie in die bestehende Infrastruktur. Ende 2026 wird die Spezialfinanzierung eine Nettoschuld ausweisen von 3,3 Millionen Franken. Daher werde zur Stabilisierung der finanziellen Situation eine Anpassung der Gebühren überprüft – und die Reduktion des Investitionsvolumens, schreibt der Stadtrat.
Im Bereich Abfallwirtschaft wird ein Unterflurcontainer gebaut, weshalb sich das Nettovermögen dieser Spezialfinanzierung auf 1 Million Franken reduziert. Nicht mehr sichtbar als Spezialfinanzierungen sind das Seniorenzentrum und die Alterswohnungen Rosenberg, die in eine kommunale Anstalt ausgelagert wurden.

Adrian von Mühlenen hat eine Vision für Zofingen – und ganz Europa

Sitzung des Einwohnerrats ist beendet: Das sind die Entscheide von heute Abend
Damit ist die heutige Einwohnerratssitzung beendet. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.
SVP bringt Postulat für mehr Sicherheit durch
Nun behandelt der Rat noch das als dringlich überwiesene Postulat von René Schindler. Er verlangt vermehrte Polizeipräsenz an neuralgischen Orten (GMS, Bahnhof oder Altstadt). Die Präsenz solle dabei fokussiert sein auf kritische Zeiten – heisst: in den Abendstunden, während und nach öffentlichen Veranstaltungen sowie zu Zeiten erhöhter Personenfrequenz. «Die vermehrte Polizeipräsenz soll kostenneutral ausgestaltet werden», verlangt die SVP. Dies könne durch die Verschiebung von Polizeiaufgaben zugunsten der Sicherheit erfolgen. Schindler fordert zudem die Prüfung und Umsetzung einer Videoüberwachung dieser neuralgischen Orte, «wie dies mit nachweislichem Erfolg beim BZZ bereits geschieht». In seinem Votum hält Schindler fest, dass das BZZ vor der Kameraüberwachung regelmässig von Vandalismus und Littering betroffen gewesen sei. Auch die Schule Oftringen habe gute Erfahrungen gemacht mit der Kameraüberwachung im Oberfeld. Er fordert, dass weitere Kameras an den oben genannten neuralgischen Punkten installiert werden, gegebenenfalls soll dann eine Erweiterung auf weitere Hotspots in Betracht gezogen werden.
Als Begründung für das Postulat führt Schindler auf, dass sich in den letzten Monaten Berichte und Beobachtungen zu sicherheitsrelevanten Vorfällen in bestimmten Bereichen der Stadt häuften. Der Vorfall am Kinderfest am 4. Juli habe gezeigt, dass es bei öffentlichen Veranstaltungen zu gefährlichen Situationen kommen könne. «Insbesondere rund um stark frequentierte Örtlichkeiten wie GMS, Bahnhof und Altstadt kommt es vermehrt zu Situationen, die für Anwohnende, Passanten und Besucherinnen eine subjektive wie objektive Unsicherheitslage erzeugen», so Schindler.
Stadtpräsidentin Christiane Guyer hält fest, dass sie das Postulat so verstehen, dass weitere Massnahmen geprüft werden sollen. «Der Stadtrat ist bereit, Massnahmen zu prüfen. Aber heute Abend entscheiden wir nicht darüber, ob wir Kameras installieren oder nicht», betont sie.
Stadtrat Lukas Fankhauser ergänzt, dass die Schule daran interessiert sei, dass der Pausenplatz nicht von Vandalismus betroffen ist. Er weist aber darauf hin, dass die Einführung von Kameraüberwachung häufig dazu führe, dass sich die Probleme an andere Orte verschieben. «Die Frage ist, ob es noch andere Möglichkeiten gibt.»
Carla Fumagalli von der GLP gibt zu bedenken, dass Sicherheitsmassnahmen oft nicht so einfach umzusetzen seien, sondern eher komplex. «Im Sinne einer Prüfung befürworten wir das Postulat», hält sie fest. Sie verlangt aber, dass geprüft wird, was denn die Grundproblematik ist und wo sich die allfälligen Hotspots befinden. «Es ist wichtig, dass wir die relevanten Stakeholder auch konsultieren und dann allenfalls Massnahmen einführen. Möglicherweise gibt es auch bessere und nachhaltigere Lösungen.»
Michael Wacker (SP) weist darauf hin, dass es für die Umsetzung von Massnahmen immer einen bewilligten Kredit brauche. Die Massnahmen könnten via Nachtragskredit bewilligt werden. «Aber: Ich weiss nicht, was die FGPK dazu sagen würde.» Zudem störe er sich daran, dass bei vermehrter Polizeipräsenz gleichzeitig Kostenneutralität bestehen soll.
Für die Fraktion FDP/ZM hält Luc Zobrist fest, dass für seine Fraktion die Sicherheit ein wichtiges Thema sei. «Bezüglich flächendeckender Videoüberwachung haben wir aber unsere Vorbehalte.» Man werde der Überweisung des Postulats aber zustimmen, weil es sich um einen Prüfauftrag handle. So könne der Stadtrat genau schauen, was sinnvoll sei – und was eben nicht.
Claudia Schürch von der EVP erachtet das Postulat von René Schindler als Misstrauensvotum gegenüber der Polizei – sie kündigt an, es nicht zu unterstützen.
Im Anschluss betont Christiane Guyer nochmals, dass die Polizei bereits heute regelmässig schaue, wo die Hotspots sind. Und sagt: «Das Gewaltpotenzial zu Hause ist am höchsten. Das ist die grösste Gefahr.» Zudem weist sie darauf hin, dass die Polizei die neuralgischen Punkte kennt und auch die aufsuchende Jugendarbeit installiert sei. «Es gibt positive Erfolge. Der Stadtrat sei aber bereit, weitere Massnahmen zu prüfen und sage Ja zur Prüfung weiterer Massnahmen, aber nicht Ja zu weiteren Kameras.
Dank Unterstützung von FDP und GLP gelingt es der SVP, das Postulat mit 22 Ja- zu 17 Nein-Stimmen zu überweisen.
Stadtrat nimmt Postulate zur Immobilienstrategie entgegen
Gleich drei Postulate zur Immobilienstrategie behandelt der Einwohnerrat anschliessend. Béatrice Zinniker (FDP) forderte den Stadtrat 2021 auf, die Immobilien-Strategie zu überarbeiten. Hans Rudolf Sommer (FGPK) beantragte 2024, dass der Stadtrat eine nachhaltige Immobilienstrategie zu erarbeiten. Und Raphael Lerch (SVP) beauftragte den Stadtrat letzten November, dem Einwohnerrat Bericht über seine Immobilienstrategie hinsichtlich der Liegenschaften des Finanzvermögens zu erstatten und den Verkauf, insbesondere des «Sennenhofs» und der Liegenschaft Vordere Hauptgasse 15/Bachgasse 2/Lindenplatz 2 zu marktgerechten Preisen «ernsthaft zu prüfen».
Der Stadtrat stimmte in seiner Haltung den Postulaten grundsätzlich zu: Er teile deren Anliegen, «wonach die städtische Immobilienpolitik gezielt, verantwortungsbewusst und im Einklang mit den strategischen Zielen der Stadt ausgestaltet werden soll». Er anerkenne zudem, «dass im Bereich Immobilien Nachholbedarf besteht».
Zur strategischen Weiterentwicklung sei eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe eingesetzt, heisst es in der Haltung weiter. Ihr gehören unter anderen die Stadtpräsidentin, sowie Vertreter und Vertreterinnen vom Ressort Hochbau, der Stadtentwicklung und der Schule. Die Arbeitsgruppe fokussiere sich auf die Schulraumplanung und die Strategie für die Finanzliegenschaften der Stadt. Derzeit werde die Immobilienstrategie intensiv überarbeitend. Auf deren Basis könnten dann Entscheide über einzelne Liegenschaften abgeleitet werden.
Der Stadtrat sei bereit, die Aufträge und Hinweise der drei Postulate in diese Arbeiten einzubeziehen. Daher beantragt er, alle drei zu überweisen.
Die Postulanten nehmen Stellung zur Antwort der Stadtrats: Hans Rudolf Sommer (SP) begrüsst im Name der FGPK, dass der Stadtrat sein Postulat überweisen will und stimmt dessen Anträgen zu.
Béatrice Zinniker (FDP) ist froh, dass endlich ein Feedback vorliege, «für mich ist aber nicht klar, warum der Stadtrat für seine Haltung fast vier Jahre Zeit brauchte.» Die Dringlichkeit habe seitdem zugenommen. Das städtische Liegenschaft-Portfolio müsse schlanker werden, der Erlös aus den Verkäufen dieser Liegenschaften könnte Investitionen zu Gute kommen. Béatrice Zinniker spricht sich aber auch dafür aus, dem Antrag des Stadtrats zu folgen. Auch Raphael Lerch (SVP) spricht sich für eine Zustimmung aus und ist gespannt, was mit den zwei Liegenschaften «Sennenhofs» und der Liegenschaft an der Vorderen Hauptgasse künftig passiert.
Einwohnerrat Michael Wacker (SP) weist darauf hin, dass es «an Arbeitsverweigerung der Abteilung Hochbau grenze», dass sie die Verwaltungsliegenschaften bisher in ihrer Strategie zu wenig berücksichtigte.
Stadtpräsidentin Christiane Guyer räumt daraufhin ein, dass es zu lange dauerte, bis die Antwort kam und Stadtrat Andreas Rüegger, der dem Ressort Hochbau vorsteht, weist darauf hin, dass die Strategie bisher nie planlos gewesen sei. Einwohnerrätin Daniela Nadler (SVP) möchte wissen, was mit dem Verwaltungsvermögen passiert, wenn die Postulate heute überwiesen werden. Christiane Guyer antwortet, dass die Verwaltungsliegenschaften weiterhin in die strategischen Arbeiten miteinbezogen sind.
Der Einwohnerrat stimmt den Anträgen des Stadtrats grossmehrheitlich zu und überweist alle drei Postulate.
Zofingen sollte sein Bauminventar jährlich prüfen
Im November 2020 reichte der damalige Einwohnerrat Gian Guyer (Grüne, inzwischen zurückgetreten) ein Postulat ein mit dem Titel «Erstellen eines Baumkonzepts». Damit forderte er den Stadtrat dazu auf, ein Baumkonzept zu erstellen, dessen Ziel es ist, den Baumbestand der Einwohnergemeinde Zofingen zu erhalten und zielgerichtet weiterzuentwickeln. Das Bauminventar solle jährlich aktualisiert werden. Der Einwohnerrat hatte den Vorstoss an seiner Sitzung vom 13. September 2021 mit 27 zu 6 Stimmen an den Stadtrat überwiesen.
Inzwischen liegt der Bericht des Stadtrats vor. Er anerkennt, dass die Bäume für die Biodiversität eine Schlüsselrolle spielen. «Nicht zu unterschätzen ist die kühlende Wirkung der Bäume im Siedlungsraum im Zusammenhang mit der Klimaveränderung», hält er fest. Der Stellenwert der Bäume für die Zofinger Bevölkerung sei unbestritten. Zudem seien einige der im Postulat geforderten Elemente und Instrumente für das Baumkonzept in der Stadt Zofingen bereits länger Praxis und würden «weiterhin konsequent umgesetzt». Die Exekutive nennt das Bauinventar, die Baumpflege, den Baumschutz, die Baumlisten sowie die Liste einheimischer Gehölzarten, die auf der Website der Stadt aufgeschaltet ist.
Mit Unterstützung eines externen Büros wurde bis Ende Jahr 2024 ein Baumkonzept erarbeitet. Die Kommission Natur und Landschaft war beratend in den Prozess involviert. Dieses enthalte eine Einschätzung mit Analyse des Ist-Zustandes des gesamten Baumbestandes der Stadt Zofingen ausserhalb des Waldes. «Als zentrales Element des Konzepts wurde das Leitbild Bäume formuliert», schreibt der Stadtrat. Dieses sei behördenverbindlich und nenne Ziele und Leitlinien, um den Baumbestand von Zofingen zu erhalten und zu ergänzen. Das Leitbild Bäume wurde am 8. Januar 2025 vom Stadtrat genehmigt. Auch das Konzept wurde an dieser Sitzung zur Kenntnis genommen.
Jürg Kast spricht für die Grünen und zeigt sich nur mässig zufrieden mit der Antwort des Stadtrats. Es fehle an konkreten Zielen, bemängelt er. Und es sei auch nicht festgehalten, welche Bäume genau geeignet seien. Daher wollen die Grünen das Postulat nicht abschreiben lassen.
Daraufhin hält Stadtpräsidentin Christiane Guyer fest, dass ein zentrales Element die Leitlinien seien. Die Priorisierung der Massnahmen stünden im Stadtrat bald zur Diskussion. Sie ist überzeugt: «Der Kernpunkt des Postulats sei erreicht.»
Fabian Grossenbacher von der SVP spricht sich für die Abschreibung des Postulats aus – und will wissen, wie viel die Erstellung des Konzepts gekostet hat. Damit verbindet er die Kritik daran, dass externe Fachpersonen beigezogen wurden. Gemäss Christiane Guyer habe die externe Begleitung rund 25’000 Franken gekostet. Für eine interne Bearbeitung hätten die Ressourcen nicht ausgereicht.
Michael Wacker (SP), der Einsitz nimmt in der Kommission Natur und Landschaft gibt zu verstehen, dass das Konzept jetzt zwar vorliege, aber auch noch viel Arbeit zu tun sei. «Die Grundlage für das Konzept und auch die Umsetzung ist hervorragend.» Daraufhin schreibt der Einwohnerrat das Postulat ab.
Vergütung von PV-Strom basiert auf Vernehmlassungsvorlage
In einer Interpellation vom 17. März 2025 zeigte sich Michael Wacker (SP) nicht einverstanden mit der Vergütung der StWZ für Photovoltaik-Strom (PV-Strom) und Preis für regional produzierten Strom. Derzeit bestehe ein Missverhältnis: Entweder würden die Stromproduzenten zu schlecht entlöhnt oder die Endkunden zu viel bezahlen. Daraus gehe «nur ein Gewinner hervor: der Stromverkäufer. Verlieren tun die PV-Stromproduzierenden sowie die Strombeziehenden», heisst es in der Interpellation. Die StWZ Energie AG gehört zu 100 Prozent Zofingen. Michael Wacker fragte den Stadtrat darum nach den Gründen für die jeweiligen Preise und ob regional produzierter Strom nicht dessen Legislaturziel «Förderung erneuerbare Energien» übereinstimme. Des Weiteren wollte er wissen, ob das aktuelle Preisregime privaten Photovoltaik-Anlagen entgegenstehe und ob der Stadtrat diese und die Produktion regionalen Stroms allgemein auf verschiedenen Wegen unterstützen würde.
In seiner Antwort schreibt der Stadtrat, dass die Vergütung für PV-Strom auf einer entsprechenden Vernehmlassungsvorlage des Bundesrats basiere. Sie soll Anreize für den Eigengebrauch von PV-Strom schaffen, um das Stromnetz zu entlasten. Zudem würde eine Reihe von Faktoren den Strompreis beeinflussen, etwa der Einkaufszeitpunkt oder die Netztopologie. Zu der Vergütung für PV-Strom stehe dem Stadtrat keine Stellungnahme zu, diese sei der StWZ als Unternehmen vorbehalten.
Der Stadtrat habe aber gegenüber der StWZ Energie AG «festgehalten, dass die Reduktion der Einspeisevergütung aus seiner Sicht verfrüht erfolgte und die Kommunikation im Zusammenhang mit dieser Anpassung ungenügend war», heisst es in seiner Antwort weiter. Die StWZ habe «argumentiert, dass sie – entgegen den Darlegungen des Postulanten – von der reduzierten Einspeisevergütung nicht profitiert». Vielmehr würden die Einnahmen zu Gute der Stromtarife kommen.
Der Stadtrat stimmt Michael Wacker zu, dass regional produzierter Strom seinen Legislaturzielen entspreche. Er begrüsse es ausdrücklich, wenn Private in PV-Anlagen investieren, diese lohnten sich besonders, wenn sie den eigenen Stromverbrauch deckten. Eigene Massnahmen, PV- und regional produzierten Strom zu fördern, seien bisher keine getroffen worden und etwa im Rahmen eines Energiereglements oder fachlicher Beratung möglich.
Michael Wacker beurteilt seine Interpellation als beantwortet.
Steuergesetzrevision: Zofingen von Mindereinnahmen betroffen
In seiner Interpellation vom 17. März 2025 wollte SP-Einwohnerrat Michael Wacker wissen, welche Auswirkungen das erste Umsetzungspaket der Steuergesetzrevision sowie die Abschaffung des Eigenmietwerts auf die Gemeinde Zofingen haben. Nun liegt die Antwort des Stadtrats vor. Bezüglich des Eigenmietwerts hält er fest, dass hierzu eine eindeutige Beantwortung zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich sei. Für Zofingen rechne das kantonale Steueramt mit einem Rückgang von 0,6 Prozentpunkten bei der Steuereinnahmen. Das entspräche rund 0,18 Millionen Franken.
Zu den Auswirkungen der Steuergesetzrevision schreibt der Stadtrat, dass diese gesamthaft erfolgsneutral verlaufe, «so dass auf den Kanton und die Gemeinden keine zusätzlichen Belastungen zukommen werden». Über die Zeit sei jedoch deutlich geworden, dass nicht alle Gemeinden gleichermassen von den Auswirkungen betroffen sein werden. «Zofingen gehört zu einer der wenigen Gemeinden, für die mit Mindereinnahmen zu rechnen ist», so der Stadtrat. Sie lägen in der Höhe von rund minus 1 Prozentpunkt. Im Budget sei dies bereits berücksichtigt. Aber: «Ausgehend von der kantonalen Annahme, dass Zofingen eine der sehr wenigen Gemeinden ist, die bei der Steuergesetzrevision Nachteile erfahren wird, ist davon auszugehen, dass Zofingen beim Steuerkraftausgleich eine bessere Position einnehmen können wird», schreibt die Zofinger Exekutive. Dadurch werde weniger in den Finanzausgleich einzuzahlen sein. Dies hänge jedoch von der generellen Steuerertragsentwicklung in Zofingen und den anderen Gemeinden ab.
Michael Wacker zeigt sich zufrieden mit der Beantwortung.
Abfall darf nicht mehr neben Abfalleimern deponiert werden
Der Einwohnerrat berät über die Überarbeitung des Abfallreglements. Das alte Reglement stammt von 2009 und entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben. Neu sollen Abfallreglement und die Abfallverordnung getrennt geführt werden. Ausserdem regelt die Stadt damit die Entsorgung an Veranstaltungen neu. Um ein entsprechendes Postulat umzusetzen, besteht für Veranstaltungen künftig die Pflicht, Mehrweggeschirr zu verwenden oder ein Nachhaltigkeitskonzept vorzulegen, teilte der Stadtrat mit. Dem Wunsch aus der Vernehmlassung, Grüngut gratis entsorgen zu können, könne nicht nachgegangen werden, heisst es vom Stadtrat weiter – der Kanton schreibe ausdrücklich eine Gebührenpflicht vor.
Thomas Affentranger (Grüne) für die FGPK stellt einen Änderungsantrag: Neu sollen verboten sein, Siedlungsabfälle oder Sperrgut bei öffentlichen Abfalleimern zu deponieren.
Die Fraktionen begrüssen das überarbeitete Reglement alle. Luc Zobrist (FDP) spricht sich im Namen der FDP- und Zofige macht’s-Fraktion für das neue Reglement aus. Man hoffe aber auf ein gewisses Augenmass in der Umsetzung und hofft, dass es künftig eher weniger Reglemente gäbe – gerade für Veranstaltungen.
Auch die glp-Fraktion begrüsst das Reglement, sagt Christian Schnider (glp). Er kritisiert nur, dass die Grünabfuhr nicht gratis sein kann. Es schaffe falsche Anreize, wenn die Grünabfuhr teurer sei, als die Schwarzabfuhr. Claudia Schürch (EVP) stellt ebenfalls einen Änderungsantrag. Für Neophyten soll die Entsorgungsgebühr entfallen.
Der Stadtrat beantragt, das revidierte Abfallreglement zu genehmigen, welches ab 2026 gelten würde. Weiter seien damit drei das Thema betreffende Postulate abzuschreiben.
Der Einwohnerrat nimmt die Änderungsanträge deutlich und die Anträge des Stadtrats je einstimmig an.
12 neue Bürger und Bürgerinnen für Zofingen
Der Rat entscheidet jetzt über sechs Einbürgerungsgesuche, darunter sind eine Familie aus Deutschland und Bolivien, eine serbische Familie und bosnisch-herzegowinischen, türkische, deutsche und bulgarische Staatsangehörige. «Alle Gesuchsteller erfüllen die Anforderungen für eine Einbürgerung. Die Einbürgerungskommission ist einstimmig dafür», sagt Raphael Lerch von der Einbürgerungskommission. Und auch der Rat hat keine Bedenken und genehmigt die Gesuche.
Neue Stimmenzählerin gewählt
Irene Lehmann heisst die neue Stimmenzählerin des Wahlbüros. Sie ist in der Stadt vor allem bekannt als langjährige Zivilstandsbeamtin. Gewählt ist sie vom Einwohnerrat mit 38 Stimmen. Anwesend sind aktuell 38 Mitglieder des Stadtparlaments.
Antrag von René Schindler zur Erhöhung der Sicherheit
René Schindler (SVP) reicht ein mit Antrag auf Dringlichkeit ein. Die Bevölkerung fühle sich nicht mehr sicher. Der Vorfall vom 4. Juli (von dem er selber betroffen war) oder Littering in der Öffentlichkeit hätten dieses Gefühl noch verstärkt. Gewünscht sei eine erhöhte Polizeipräsenz und Überwachungskameras im öffentlichen Raum. Gerade am neuen Oberstufengebäudes könnten jetzt, da es noch gebaut wird, noch gut Kameras angebracht werden.
Der Stadtrat sei über die Ereignisse am 4. Juli ebenfalls betroffen, sagt Stadtpräsidentin Christiane Guyer. Die Repol schaue aber durchaus hin. «Wir haben in Zofingen grundsätzlich kein Sicherheitsproblem». Sie beantragt, das Postulat nicht als dringlich zu behandeln.
Es erfolgt die Abstimmung über die Dringlichkeit des Postulats. Der Rat erachtet das Postulat mit 26 Ja-Stimmen zu 11 Nein-Stimmen als dringlich. Somit wird es heute noch behandelt.
SVP will Änderung auf Traktandenliste
Ratspräsident Matthias Hostettler (Grüne) begrüsst den Einwohnerrat. Wie üblich, fragt er, ob es Änderungswünsche für die Traktandenliste gibt. Und tatsächlich: Die SVP-Fraktion beantragt eine Änderung. Das Geschäft «Überbauung Untere Vorstadt – Einräumung eines Baurechts» soll auf die nächste Versammlung verschoben werden. Marco Negri argumentiert in seinem Votum, dass man nur eine kurze Vorbereitungszeit gehabt habe. Es seien noch zu viele Fragen ungeklärt, bei so einem wichtigen Geschäft. Darum hat die SVP dem Stadtrat noch vor der Sitzung mehr als 40 Fragen zugestellt. Stadtpräsidentin Christiane Guyer spricht sich im Namen des Stadtradts für eine heutige Behandlung aus. Es seien Fachleute beigezogen worden und heute entscheide man nur über die Einräumung des Baurechts. Und alles, was den Baurechtsvertrag betreffe, nehme man gerne auf. Dieser werde noch endverhandelt. Michael Wacker (SP) hält daraufhin fest, dass es nur um das Baurecht gehe und nicht um den Vertrag. Ähnlich sieht es Claudia Schürch (EVP). Es gehe um die Gutheissung der Eckwerte. Es sei nicht sinnvoll, Details auszuformulieren. Der Rat soll sich auf seine Aufgabe konzentrieren. Tobias Hottiger (FDP) ergreift Partei für das Anliegen der SVP. «Wir wollen am Schluss ein gutes Projekt», sagt er. Es sei nichts dabei, das Thema noch ein, zwei Monate aufzuarbeiten. Marco Negri betont im Anschluss, dass es der SVP nicht darum gehe, das Projekt zu torpedieren. Letzlich stimmt der Rat dem Antrag der SVP mit 19 Ja- zu 16 Nein-Stimmen zu.
Das ist das Programm von heute Abend
Guten Abend und herzlich willkommen zum Liveticker des Zofinger Tagblatts aus dem Einwohnerrat. Folgende Themen stehen heute zur Debatte: Ersatzwahl eines Stimmenzählers/einer Stimmenzählerin des Wahlbüros für den Rest der laufenden Amtsperiode 2022 bis 2025, Einbürgerungen, die Einräumung des Baurechts für die Überbauung Untere Vorstadt, die Revision des Abfallreglements, die Interpellation von Michael Wacker (SP) zu den Auswirkungen der Steuergesetzrevision und der Abschaffung des Eigenmietwerts, die Interpellation von Michael Wacker zum Thema «Strompreise in Zusammenhang mit der Einspeisevergütung der StWZ», das Postulat von Gian Guyer (Grüne) betreffend «Erstellen eines Baumkonzepts» sowie drei Postulate zum Thema Immobilienstrategie.

«Zofingen soll leben» – Pjetër Markaj setzt auf Austausch und Sachpolitik

Ditaji Kambundji gewinnt sensationell WM-Gold über 100 Meter Hürden
Die 23-jährige Ditaji Kambundji schreibt in Tokio Schweizer Sportgeschichte und wird als erste Schweizer Frau Weltmeisterin in der Leichtathletik.
Sie pulverisiert im Final über 100 m Hürden ihren eigenen Schweizer Rekord um 16 Hundertstelsekunden auf neu 12,24. Die Bernerin zeigt einmal mehr ihre unglaubliche Nervenstärke im entscheidenden Moment. Nach Nerven aus Stahl während des Rennens kommen die Emotionen nach dem Lauf.
Die zehn Jahre jüngere Schwester von Mujinga Kambundji holt nach Kugelstösser Werner Günthör (1987, 1991 und 1993) sowie 800-m-Läufer André Bucher (2001) als dritte Person und erste Frau Schweizer WM-Gold in der Weltsportart Leichtathletik. Die bislang einzigen zwei WM-Bronzemedaillen für Schweizer Athletinnen gehen auf das Konto von Anita Weyermann (1997 über 1500 m) sowie Mujinga Kambundji (2019 über 200 m).
Ditaji Kambundji denkt zweifellos auch an ihre zehn Jahre ältere Schwester, die in Kürze ihr erstes Kind erwartet und danach ein Comeback plant, als sie gegenüber SRF sagt: «Ich habe mir nie eine Limite gesetzt und hatte immer Vorbilder, die mir zeigten, dass alles möglich ist.»

Ein Zofinger und ein Brittnauer dürfen sich als Meister feiern lassen

Wo Pflastersteine Funken schlagen: Kultur i de Gass ist ein Mix, der alle abholt
Fabian Zemp vom Veranstalter Palass Sessions hat die zündende Idee für ein Kulturfestival der anderen Art in Zofingen – und bringt die Stadt damit zum Knistern. Corina Friderich, Inhaberin der Leserei und Andi Hofmann, Betriebsleiter des Oxils sind sofort Feuer und Flamme.
Halb gratis, ganz gemeinsam
Die Überzeugung hinter dem Projekt: Arbeiten die drei Institutionen gut orchestriert zusammen, schaffen sie ein Ganzes, das mehr ist als die Summe aller Einzelteile. Sprich: Palass Sessions, Oxil und Leserei tragen mit ihrer je ganz eigenen Note zu einem Mix bei, der nicht nur Stammpublikum, sondern die breite Bevölkerung abholt. Halb gratis auf der Gasse unter freiem Himmel, halb kostenpflichtig im Palass.
Auf den Pflasterstein gebracht heisst das «Kultur i de Gass» – konzentriert auf die rund 90 Meter von der Schifflände bis zum Palass. Es ist Zofinger Altstadt pur: In Wohnzimmeratmosphäre können sich Schaulustige mit Streetfood verköstigen – und entspannt Strassenkunst geniessen.
Programm Kultur i de Gass
Kultur i de Gass findet statt am Samstag, 20. September ab 14 Uhr in Zofingen. Kostenloses Outdoorprogramm mit Strassenkunst, Lesung Queer Kids (Christina Caprez), Singer/Songwriter Kleeby und der Zofiner Band Karlitas um jeweils 15 und 19 Uhr.
Kostenpflichtiges Programm im Palass zu je 20 Franken Eintritt:
15.45 Uhr, Palass (Oxil): Odd Beholder – Electro-Wave zwischen Eskapismus und neuer Welt.
17.15 Uhr, Palass (Leserei): Pedro Lenz & Simon Spiess – «Zärtlechi Zunge» trifft Ambient-Sax.
20.30 Uhr, Palass (Palass Sessions): Andryy – Singer-Songwriter, Swiss-Music-Award-nominiert.
Feuer, Poi, Burlesque: Kunst auf Armlänge
Ab 14 Uhr geht’s los: Luca und Noel spielen mit dem Feuer, Allan und Lorena wirbeln Maori-Pois, Angelo und Jule performen – abends sogar Burlesque. Singer/Songwriter Kleeby liefert Lagerfeuersound. Die Karlitas lassen um 15 und 19 Uhr ihre Klänge durch die Gasse tanzen. Dazwischen wird’s nachdenklich: Christina Caprez liest aus «Queer Kids», ihrem Buch, das 14 Jugendlichen eine Stimme gibt. Für die Kleinsten gibt’s ein Spielangebot.
Andi Hofmann ist überzeugt von Poesie, Spektakel und Tiefgang dieses Kulturanlasses. «Verschiedene Generationen, Kulturen und Vielfalt begeistern mich – ich hoffe das Publikum lässt sich anstecken.»
Die Leserei präsentiert um 17.15 Uhr «Zärtlechi Zunge» im Palass. So heisst der neuste Wurf von Pedro Lenz, dessen Mundarttexte live performt erst so richtig vom Ohr bis ins Herz gluckern. Der in Aarburg aufgewachsene und stark mit Zofingen verbundene Saxophonist Simon Spiess tritt mit Ambient Sounds in Zwiesprache mit Lenz’ funkelnd zärtlichen Texten über vollkommene Momente inmitten menschlicher Unzulänglichkeiten.
Andi Hofmann freut sich auf den Oxil-Beitrag. Die Einstiegssession um 15.45 Uhr im Palass ist elektrisch untermaltes Kino. Die «Music Declares Emergency»-Nachhaltigkeitsaktivistin Daniela Weinmann schickt mit «Odd Beholder» ihren poetischen Kahn voller nachdenklicher Texte auf einen Fluss, der Electro Wave, Indie Pop und Art Pop miteinander verquirlt.
«Es ist alles angerichtet»
Palass Sessions präsentiert schliesslich um 20.30 Uhr den Singer/Songwriter Andryy. Der Multiinstrumentalist aus Winterthur wurde jüngst für den Swiss Music Award nominiert und wird nicht zuletzt dank seiner charakteristischen Stimme und seiner Feinfühligkeit aktuell fleissig im Radio gespielt. «Als er erstmals bei uns war vor zwei Jahren, war er noch kaum bekannt», meint Fabian Zemp, «umso mehr freut es mich, dass er nun erneut im Palass aufspielt.»
«Es ist alles angerichtet», sagt Andi Hofmann. Bleibt nur noch: neugierig sein, vorbeikommen – und gutes Wetter mitbringen. Bei Regen zieht das Fest in die Markthalle.