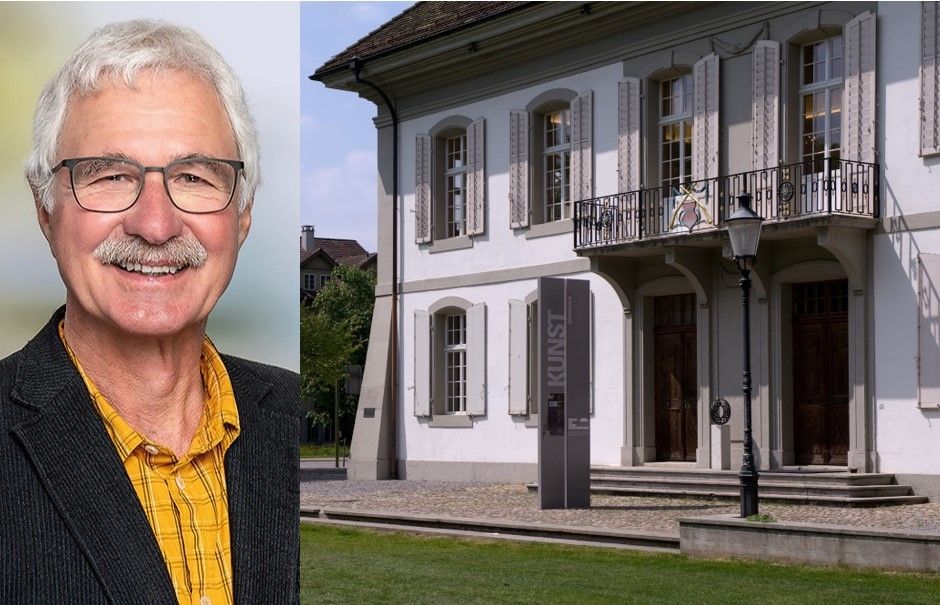«Ich finde es wichtig, dass die Jungen vertreten sind»

Ursula Forsblom setzt sich für eine belebte Altstadt für alle Generationen ein

Zurück am sportlich geprägtem Ursprungsort regionaler Politik
«Ernst Baumann, Attelwiler Gemeindemann, lud einst die Räte der benachbarten Gemeinden Kirchleerau, Moosleerau, Reitnau, Staffelbach und Wiliberg zum ersten Obersuhrentaler Gemeinderatsschiessen ein», führte Katrin Burgherr-Burgherr, Gastgeberin und Gemeindeammann Reitnau aus. Wahrscheinlich kamen auch brisante Themen zur Sprache, die die beteiligten Gemeinden betrafen. Zwischenzeitlich dient der Anlass dem informellen Plausch und Kennenlernen neuer Räte, Schreiber und sonstigen Verwaltungsangestellten. Neben den bereits erwähnten Gemeinden kamen Schöftland, Schlossrued und Schmiedrued hinzu, Hirschthal erfreute sich einer erstmaligen Einladung. Von einem reinen Obersuhrentaler Anlass kann kaum noch gesprochen werden, der Kreis erweitert sich.

Die Scheiben im Visier: Nicht jeder Schuss ging ins Schwarze, der Umgang mit dem Gewehr muss geübt sein, aber alle machten mit. – Alfred Weigel 
Die Teilnehmenden lauschen den Einführungen zum Obersuhrentaler Gemeinderatsschiessen beim Schützenhaus Attelwil. – Alfred Weigel 
Die Teilnehmenden lauschen den Einführungen zum Obersuhrentaler Gemeinderatsschiessen beim Schützenhaus Attelwil – Alfred Weigel 
Die Scheiben im Visier: Nicht jeder Schuss ging ins Schwarze, der Umgang mit dem Gewehr muss geübt sein, aber alle machten mit. – Alfred Weigel 
Die Scheiben im Visier: Nicht jeder Schuss ging ins Schwarze, der Umgang mit dem Gewehr muss geübt sein, aber alle machten mit. – Alfred Weigel 
Bruno Lehmann (links) von den Feldschützen Attelwil orientiert über Historie und Ablauf des Schiessens. – Alfred Weigel 
Gemeindeschreiber Marc Hochuli überreichte ein Präsent der anlassorganisierenden Katrin Burgherr-Burgherr. – Alfred Weigel
Nicht alle erwiesen sich so treffsicher wie die Sportschützen unter den Teilnehmenden. Geschossen wurde auf die Scheibe A100 mit zwei Probeschüssen und zehn gewerteten. Schützenmeister halfen den Ungeübteren. Als bester Schütze erwies sich einmal mehr der Kirchleerber Ammann Erich Hunziker mit 93 von 100 möglichen Zählern. Für ihn ein krönender Abschluss vom Obersuhrentaler Gemeinderatsschiessen, denn er tritt am 28. September nicht mehr zur Wiederwahl an. Die Gemeindewertung entschied Kirchleerau mit einem Durchschnitt von 82 ebenfalls für sich und verwies Schlossrued (mit 74) und Moosleerau auf die Plätze.
«Reitnau hat ein Luxusproblem mit zwei Schützenhäusern, eines an der Bergstrasse, das andere in Attelwil.» Bruno Lehmann von den Feldschützen Attelwil orientierte vor dem Schiesswettbewerb über den Verein. «Leider nimmt die Zahl der Schützenvereine und der Schützen in der Region stetig ab. Frauen und Jungschützen kompensieren dies kaum», sagt er. Kein Schiessen ohne Nachtessen. Beim Pizza-Plausch gingen alle zum gemütlichen Teil über, nicht aber ohne das eine oder andere Thema bilateral anzusprechen. Intensiv diskutierten die Gemeinderäte die anstehende Verwaltungsratswahl der Eniwa AG, Aarau.

30 Jahre Kita Domino – jeder Tag ein Stück Glück
Aus der ehemaligen Kinderkrippe Domino ist in den vergangenen drei Jahrzehnten eine Tagesstätte für Kinder entstanden, die aus Zofingen nicht mehr wegzudenken ist. Zu den Geburtshelferinnen gehörte damals auch die Zofinger Stadtpräsidentin Christiane Guyer, die an den Feierlichkeiten vom Samstag auf die Anfangsjahre zurückblickte. Die Kita Domino sei erwachsen geworden und trotzdem jung geblieben, bunt und fröhlich, sagte sie. Guyer verwies auf ein auf der Kita-Domino-Homepage aufgeschaltetes Zitat, wonach die ersten sechs Jahre im Leben eines Menschen wichtiger seien als sechs Jahre Studium und eine dreijährige Weltreise. Ein Zitat, das die Philosophie der Kita Domino präge. «Jeder Tag ist ein kleines Stück Glück», betonte die Stadtpräsidentin.
Dabei sei der Anfang gar nicht so einfach gewesen. Die Idee, in Zofingen eine Kindertagesstätte zu schaffen, habe fünf Jahre Garzeit gebraucht, bis sie umgesetzt werden konnte. Das Einreichen einer Motion im Parlament bezeichnete Christiane Guyer als Schlüsselmoment – die darin formulierte Forderung nach einer Kinderkrippe sei knapp mit 18:17 Stimmen angenommen worden. Los ging es am 7. Januar 1995 mit sieben Kindern.

30 Jahre Kita Domino: Impressionen von der Theatervorführung. – Jil Lüscher 
30 Jahre Kita Domino: Grosses Kino was die Kleinen gezeigt haben. – Jil Lüscher 
30 Jahre Kita Domino: Einradfreestyleshow als Attraktion – Jil Lüscher 
30 Jahre Kita Domino: Mehr Menschen als erwartet. – Jil Lüscher 
30 Jahre Kita Domino. – Jil Lüscher 
30 Jahre Kita Domino: – Jil Lüscher 
30 Jahre Kita Domino: Papa hilft auf dem Spielparcours. – Jil Lüscher 
30 Jahre Kita Domino: Romeo preist seine coole Ware an. – Jil Lüscher 
30 Jahre Kita Domino: Tanz und Spass für Gross und Klein. – Jil Lüscher 
30 Jahre Kita Domino: Theatervorführung im Stadtsaal. – Jil Lüscher 
30 Jahre Kita Domino: Und ab geht die Post. – Jil Lüscher
Inzwischen ist eine ganze Generation ins Land gezogen, wer damals in der Kita Domino als Kind betreut wurde, war am Samstag vielleicht als Elternteil an den Jubiläumsfeierlichkeiten anwesend. «Wir haben nicht mit so vielen Menschen gerechnet» sagte Stefano Di Giusto, der Präsident des Vereins Kindertagesstätte Domino. Er lobte das OK-Team, das unter der Leitung von Sarah Baiocco mit viel Herzblut einen grossartigen Tag auf die Beine gestellt habe.
Weil das Wetter mitmachte, wurde vor allem im Freien gefeiert, mit einem Flohmarkt und vielen Attraktionen, darunter auch eine rührende Theatervorstellung. Die Kita Domino bietet den Kindern unter der langjährigen Leitung von Mesude Alkan in der Tat viel Erfreuliches und Wertvolles fürs Leben.

Luzerner Berufsnachwuchs räumt ab

Immobilienstrategie: Stadtrat sieht Handlungsbedarf und will drei Postulate entgegennehmen
Béatrice Zinniker (FDP), Hans Rudolf Sommer (SP) und Raphael Lerch (SVP) haben etwas gemeinsam. In den Jahren 2021 respektive 2024 haben sie alle je ein Postulat eingereicht, das die Immobilienstrategie der Stadt Zofingen thematisiert. In jenem von Zinniker wird die Exekutive aufgefordert, die Immobilienstrategie der Stadt Zofingen «aufgrund der ungenügenden Selbstfinanzierung, des ausserordentlich hohen Investitionsbedarfs der nächsten Jahre und der damit verbundenen Verschuldung zu überarbeiten und der aktuellen Ausgangslage anzupassen». Insbesondere das Halten und weitere Erstellen und Erwerben von Anlageliegenschaften/Renditeobjekten sei kritisch zu hinterfragen. Gezielte Desinvestitionen im Bereich Anlageliegenschaften seien aufgrund der prognostizierten Verschuldungssituation zu prüfen.
In seinem Postulat fordert Hans Rudolf Sommer den Stadtrat dazu auf, eine nachhaltige Immobilienstrategie zu erarbeiten. «Sie soll als wichtiges Führungsinstrument für die Bewirtschaftung und für den Werterhalt des umfangreichen Bestands von rund hundert Gebäuden im Verwaltungs- und im Finanzvermögen der Stadt dienen.» Zusätzlich soll sie Antworten für die anstehenden Herausforderungen wie Stadtentwicklung, Bevölkerungswachstum, wandelnde Ansprüche, Erfüllung der Klimaziele und Finanzierbarkeit liefern. Lerch wiederum will mit seinem Postulat die Exekutive damit beauftragen, dem Einwohnerrat Bericht über seine Immobilienstrategie hinsichtlich der Liegenschaften des Finanzvermögens zu erstatten und den Verkauf, insbesondere des «Sennenhofs» und der Liegenschaft Vordere Hauptgasse 15/Bachgasse 2/Lindenplatz 2 zu marktgerechten Preisen «ernsthaft zu prüfen».
Stadtrat anerkennt die Wichtigkeit
Der Stadtrat beantragt dem Einwohnerrat an der Sitzung vom Montag, sämtliche Postulate zu überweisen. In seiner Haltung hält er fest, dass er einer «vorausschauenden und nachhaltigen Immobilienentwicklung eine hohe Bedeutung» beimesse. Er teile die Anliegen der vorliegenden Postulate, wonach die städtische Immobilienpolitik «gezielt, verantwortungsbewusst und im Einklang mit den strategischen Zielen der Stadt» ausgestaltet werden soll. «Dabei stehen der sorgfältige Umgang mit den Finanzliegenschaften, die langfristige Sicherstellung von Raum für öffentliche Aufgaben sowie eine ausgewogene Abwägung von Halten, Entwickeln oder Veräussern im Zentrum», heisst es in der Vorlage an den Einwohnerrat.
Der Stadtrat anerkennt darin, dass im Bereich Immobilien Nachholbedarf besteht. Zur strategischen Weiterentwicklung sei eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe eingesetzt worden. Die Arbeitsgruppe verfolgt zwei Hauptschwerpunkte: die Schulraumplanung und die Strategie für die Finanzliegenschaften der Stadt. Auch die Zielsetzungen zu den Finanzliegenschaften würden sich zurzeit in Bearbeitung befinden, so der Stadtrat. «Diese werden systematisch hinsichtlich ihrer strategischen Bedeutung und wirtschaftlichen Tragbarkeit überprüft.»
Derzeit werde auch intensiv an der Überarbeitung der Immobilienstrategie gearbeitet, hält die Exekutive fest. «Basierend auf dieser übergeordneten und langfristigen Strategie können anschliessend Entscheide zu den einzelnen Liegenschaften abgeleitet werden.»

Wolfsrudel schrecken die Schweiz auf – weil sie sich plötzlich Rinder reissen

«Ich habe Biss» – so kam «Sohlenblitz Fritz» zu seinem 100. Waffenlauf

Dank Baurechtsvertrag soll die Untere Vorstadt weiterhin in der Hand der Stadt Zofingen bleiben

Nach vier Jahrzehnten: Offizielle Einweihung des Dalchenbachs
Mit einem kleinen Einweihungsfest wurde der Dalchenbach in Strengelbach am Freitagabend feierlich offiziell eingeweiht. Anfang August konnten die im April 2025 gestarteten Bauarbeiten bereits beendet werden (wir berichteten).
Anwesend waren nebst dem Gemeinderat auch Stefan Bolliger vom Ingenieurbüro Emch+Berger sowie Sebastian Hackl, Projektleiter Wasserbau beim Kanton Aargau. Auch ein paar dutzend Strengelbacherinnen und Strengelbacher wohnten der kleinen Feier mit anschliessendem Apéro bei.
Projekt mit 40 Jahren Vorgeschichte
«Heute ist ein spezieller Tag für Strengelbach», sagte Walter Schläfli, Gemeinderat und zuständig für das Ressort Tiefbau und Liegenschaften, während er einige Worte an die Anwesenden richtete. Das Projekt Dalchenbach beschäftigte die Gemeinde Strengelbach seit 1985 – eine lange Zeit. Auch Stefan Bolliger, der über die verschiedenen Bauarbeiten informierte, bestätigte dies: «Der Bach beschäftigt mich schon mein ganzes Berufsleben.»
Gemeinsam wurde der neue Bach abgelaufen, um sich anschliessend bei einem Apéro auszutauschen – inklusive Dalchen-Bier.

Das Dalchen-Bier mit Dörfli-Wasser, gebraut von Gemeinderat Walter Schläfli. – Bild: Gemma Chillà 
So sieht der Bach aus. – Bild: Gemma Chillà 
Strengelbacherinnen und Strengelbacher wohnten der Einweihung des Dalchenbachs bei. – Bild: Gemma Chillà 
Der Dalchenbach wurde mit einem Apéro eingeweiht. – Bild: Gemma Chillà 
Beim Bau des Dalchenbaches wurde auch auf einen geeigneten Lebensraum für kleine Lebewesen im Wasser geachtet. – Bild: Gemma Chillà

«Manchmal muss man im Leben einfach aus der Komfortzone ausbrechen»

Müller Martini zentralisiert ihre Strukturen und die Stadt Zofingen gewinnt 200 Arbeitsplätze
Nach der Übernahme vor zwei Jahren folgt nun die Integration: 200 Arbeitsplätze der Hunkeler AG in Wikon werden nach Zofingen zu Müller Martini verlegt. Dies vermeldete die Nachrichtenplattform punkt4info. Die Reorganisation sei eine Reaktion auf die veränderten Marktbedingungen und solle die Widerstandsfähigkeit der Müller Martini Gruppe steigern. Denn die hohen Zölle im Schlüsselmarkt der USA sowie Währungsverluste belasten die Geschäftsentwicklung. Gleichzeitig sei die Investitionsbereitschaft der globalen Kundschaft kleiner geworden.
Die Hunkeler AG produziert in Wikon Papier-Finishing-Systeme und ist seit 1922 in der Druckindustrie tätig. Als das Unternehmen vor zwei Jahren durch Müller Martini übernommen wurde, beschäftigte es etwa 280 Mitarbeitende rund um den Globus. Bei der Übernahme wurde damals angekündigt, dass es zu keinen Entlassungen komme. Dieses Ziel wird auch jetzt kommuniziert: Ein Personalabbau, der über die natürliche Fluktuation und Pensionierungen hinausgeht, sei nicht geplant, schreibt punkt4info. Trotz der Integration in Zofingen bleiben die Marke Hunkeler genauso wie der Hunkeler Innovationday als Branchenevent erhalten. Bis Ende 2026 soll die Integration in Zofingen abgeschlossen sein.
Nicht von der Zentralisierung betroffen sei die Hunkeler-Tochter Hunkeler Fertigung AG, schreibt der Willisauer Bote. Der regionale CNC-Lohnfertiger für Bauteile für die Maschinenindustrie bleibt mit 34 Mitarbeitern weiterhin in Wikon.
Wikons Gemeindepräsident André Wyss hat nach der Übernahme von Hunkeler durch Müller Martini im Jahr 2023 damit gerechnet, dass die Zusammenführung an einem Standort eines Tages kommen wird. Trotzdem sei dies nun ein herber Schlag. «Wir verlieren ein hier stark verwurzeltes Unternehmen, das den Namen Wikon in die weite Welt hinaustrug», sagt er gegenüber dem Willisauer Boten. Entsprechend dankbar ist Wyss, dass die Hunkeler Fertigung weiterhin in Wikon produzieren wird – und die Arbeitsplätze von Hunkeler in der Region erhalten bleiben.