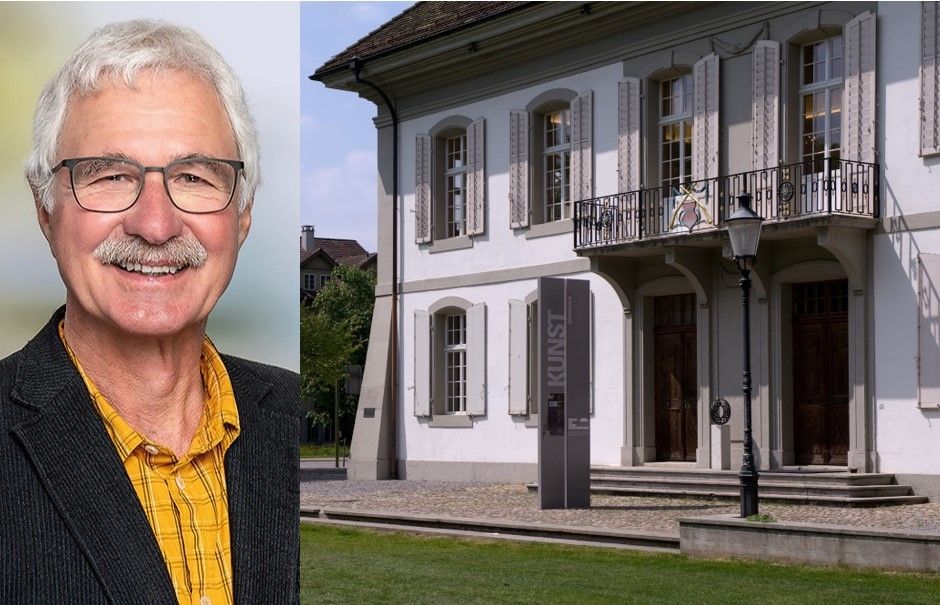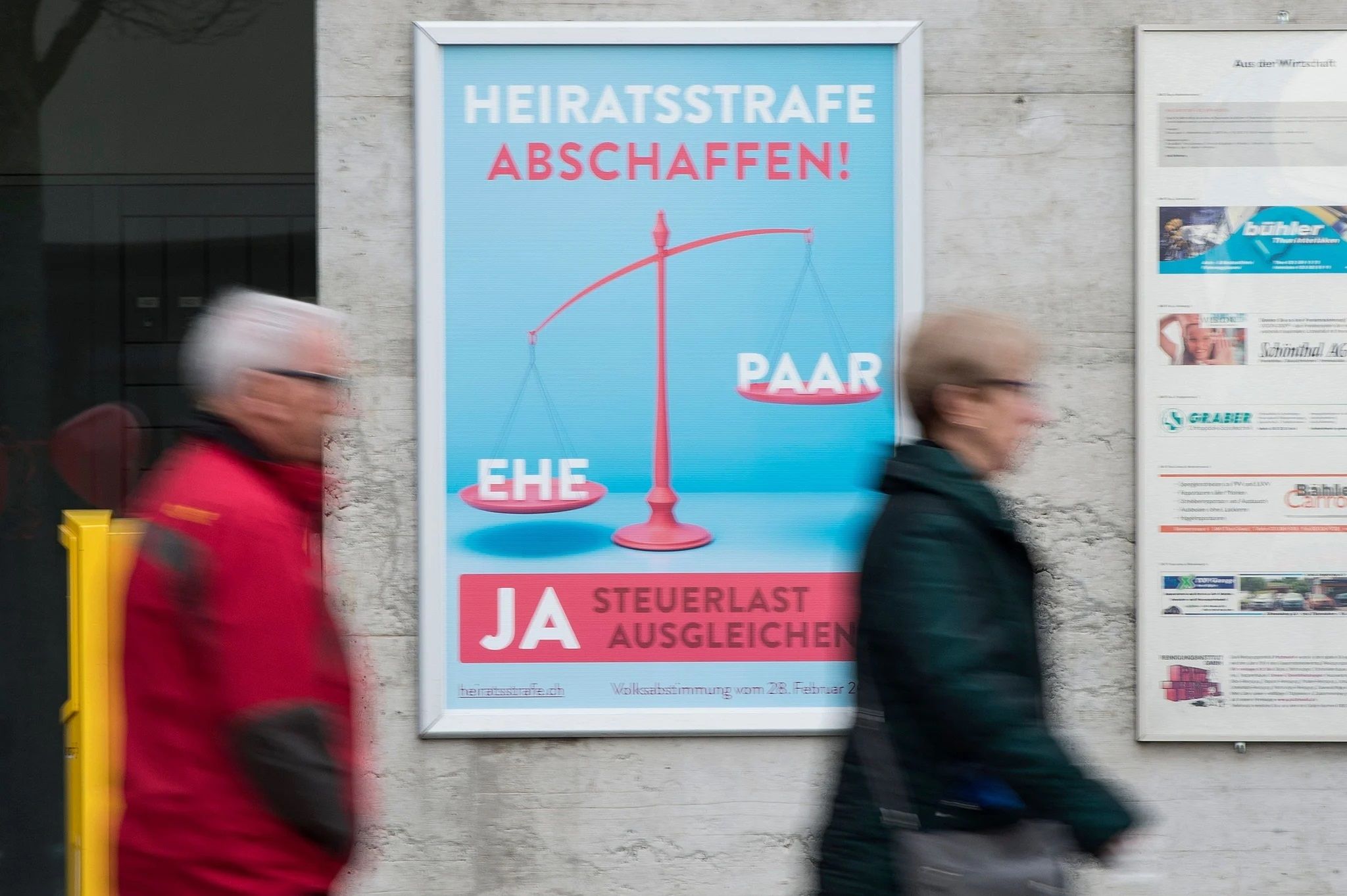Stadtratswahlen Aarburg: Acht Fragen an die Kandidierenden

Trotz Rückzug aus St. Urban: Luzerner Regierung will päpstliche Privilegien nicht aufgeben

Sprudelnde Steuereinnahmen: Brittnau schliesst das Jahr 2024 mit einem Millionengewinn ab
Die Jahresrechnung 2024 der Einwohnergemeinde Brittnau schliesst mit einem Gewinn von rund 1,6 Millionen Franken ab. Gerechnet hat die Gemeinde mit einem Überschuss von rund 218‘000 Franken.
Das positive Ergebnis sei durch verschiedene Faktoren zustande gekommen, teilt die Gemeinde in einer Medienmitteilung mit. Einen erheblichen Anteil daran hätten die Steuererträge, die um einiges höher ausfielen als budgetiert. Rund 1 Million Franken mehr als geplant spülten die Steuern in die Gemeindekasse. Der gesamte betriebliche Aufwand wurde gegenüber dem Budget um rund 128‘000 Franken unterschritten. Einzig im Bereich Ausgaben Gesundheit musste Brittnau rund 320‘000 Franken mehr ausgeben als geplant. Die anderen Funktionen liegen im Rahmen der Budgets oder weisen Minderausgaben auf.
Das Ergebnis aus der Finanzierung (Finanzaufwand/Finanzertrag) schliesst um 16‘500 Franken besser ab als budgetiert. Die Kapitalmärkte ermöglichten es, liquide Mittel mit Zinserträgen anzulegen. Im laufenden Jahr sind die Zinsen wieder eingebrochen und es darf nicht mehr mit Zinserträgen gerechnet werden.
Das ausserordentliche Ergebnis ist lediglich als Buchwert zu betrachten – das heisst, es sind dabei keine Geldmittel geflossen. Hierbei handelt es sich um eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve, heisst es in der Mitteilung weiter. Unter dem Strich erzielt das Rechnungsergebnis 2024 inklusive Spezialfinanzierungen eine Selbstfinanzierung von rund 2,7 Millionen Franken. Anstelle der budgetierten Nettoinvestitionen von rund 6,4 Millionen Franken zeigt die Investitionsrechnung ein Ergebnis von 582‘000 Franken und somit einen Finanzierungsüberschuss von rund 2 Millionen Franken. Die für 2024 geplanten Ausgaben (unter anderem den Neubau des Werkhofs und des Feuerwehrgebäudes) für Investitionen konnten noch nicht umgesetzt werden. Die Ausgaben sind aber lediglich aufgeschoben auf die nachfolgenden Jahre.
So zeigt sich die Situation bei den Spezialfinanzierungen
Das Wasserwerk weist einen Gewinn von rund 246’000 Franken aus – gerechnet hat die Gemeinde mit einem solchen von 176’000 Franken. Auch bei der Abfallbewirtschaftung sieht es gut aus. Hier resultiert ein Gewinn von rund 61’000 Franken. Budgetiert war ein Überschuss von rund 4000 Franken. Einzig die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Minus von rund 80’000 Franken ab. Gerechnet hat die Gemeinde mit einem Verlust von rund 137’000 Franken. Alle drei Spezialfinanzierungen können ihre Rechnungen mittels eines stattlichen Eigenkapitals ausgleichen. Im Wasserwerk und bei der Abwasserbeseitigung konnten Anschaffungen, Unterhalt und Investitionen nicht im geplanten Rahmen getätigt werden. Auch diese sind lediglich aufgeschoben und werden in den kommenden Jahren zu Ausgaben führen.
Die Einwohnergemeinde Brittnau weist per Ende 2024 ein Nettovermögen von über 12 Millionen Franken auf. Das entspricht rund 2800 Franken pro Einwohner. Das Investitions- und Amortisationspotenzial kann als mittel eingestuft werden. Der Selbstfinanzierungsanteil liegt bei 15,65 Prozent.
Gutes Resultat bei der Ortsbürgergemeinde
Die Ortsbürgergemeinde Brittnau weist im Jahr 2024 einen Gewinn von rund 108’000 Franken auf. Budgetiert war ein Überschuss von rund 61’000 Franken. Das gute Resultat ist unter anderem den Minderausgaben für die Bewirtschaftung des Waldes und bei den Forstarbeiten durch Dritte zu verdanken. Weiter wurde budgetierter Unterhalt an Grundstücken nicht ausgeführt. Die Forstwirtschaft schliesst mit einem Gewinn von rund 72’000 Franken ab. Budgetiert war ein Gewinn von rund 47’000 Franken. Aus der Ortsbürgerschaft ohne Forst resultiert ein Ertragsüberschuss von rund 36’000 Franken.
Das gesamte Eigenkapital der Ortsbürgergemeinde inklusive Aufwertungsreserven ist somit auf über 10,9 Millionen Franken angewachsen.

Hartes Ringen um Velokeller und knapper Entscheid bei Pfistergasse: So hat der Einwohnerrat am Montagabend entschieden
In seiner Interpellation stellte Matthias Hostettler (Grüne) dem Stadtrat fünf Fragen betreffend «Verkehrssicherheit und Verhalten von Armeefahrzeugen im Schulumfeld Rosengartenstrasse». Nun liegt die Beantwortung des Stadtrats vor.
Unter anderem wollte Hostettler wissen, wie der Stadtrat die Lage der Armeeunterkunft Rosengarten/Bezirksschule direkt neben Schulwegen und einem Wohnquartier beurteilt. Darauf antwortet der Stadtrat, dass er die Militärunterkunft Rosengarten beibehalten wolle, ein Ausbau sei aber nicht geplant. «Die Koexistenz der Militärunterkunft und der Zivilschutzanlage Ost mit dem Gemeindeschulhaus und Oberstufenzentrum ist grundsätzlich möglich», hält er fest. Zu priorisieren sei dabei die Verkehrssicherheit, mit dem Ziel, ein harmonisches Nebeneinander von Schule, Schulweg, Wohnquartier und Truppenunterkunft zu erreichen. Hostettler wollte zudem wissen, mit welchen Massnahmen die Verkehrssicherheit erhöht werden soll.
Darauf entgegnet die Zofinger Exekutive, dass sie im April 2024 ein Park- und Halteregime für Armeefahrzeuge eingeführt hat. Daran hält der Stadtrat fest, ebenso an der Umsetzung der Lösung Elterntaxi beim Stadtsaal. Er plane keine zusätzlichen Massnahmen. «Selbstverständlich wird die Verkehrssituation rund um die Schulanlagen genau beobachtet und weiterhin ein Aktions-Hotspot der Regionalpolizei Zofingen in diesem Perimeter definiert.» Ausserdem sei der Stadtrat in Verhandlungen mit dem Baudepartment betreffend partieller Einführung von Tempo 30 auf der Rosengartenstrasse.
Hostettler stellte auch die Frage: «Welche Massnahmen wären nach Ansicht des Stadtrats zielführend, um geeignete Abstellflächen für die Fahrzeuge festzulegen, die nicht die Sicherheit der Kinder gefährden?» Darauf entgegnet die Exekutive, dass sie sich bewusst sei, dass das derzeitige Verkehrsregime für die Militärfahrzeuge als Übergangslösung während der Bauzeit des Oberstufenzentrums zu betrachten und suboptimal ist. Der Stadtrat will in der Folge die Anliegen Abstellflächen für Fahrzeuge (inkl. militärische Fahrzeuge bei Truppenbelegungen in der Militärunterkunft Rosengarten), das Verkehrsregime rund um die betroffenen Schulanlagen (inkl. Verkehrsregime für Militärfahrzeuge) sowie die Schulwegsicherheit als solches im Rahmen des Verkehrskonzepts Oberstufenzentrum berücksichtigen.
Und zuletzt will Hostettler noch wissen, welche Schritte die Stadt unternehmen könne, «um sicherzustellen, dass der Abdankungshallenparkplatz während der Schulzeiten für Eltern zugänglich bleibt, um die „Elterntaxi“-Situation zu entschärfen?» Der Stadtrat hält hierzu fest, dass der Parkplatz bei der Abdankungshalle für Elterntaxis nicht geeignet sei. Zur Entschärfung der Elterntaxi-Situation im Schulraum Rosengartenstrasse müsse das Vorhaben mit den eingeleiteten Massnahmen beim Stadtsaal priorisiert werden, «um die unerwünschten Bring- und Holfahrten im Gebiet Gemeindeschulhaus und Oberstufenzentrum koordinieren zu können».
Interpellant Matthias Hostettler sagt, dass er teilweise zufrieden ist mit der Antwort des Stadtrates und nimmt diese so zur Kenntnis.
Hartes Ringen um Velokeller an der Florastrasse: Einwohnerrat nimmt Vorlage des Stadtrates an
Jetzt geht es weiter mit einer ebenso umstrittenen Vorlage. Der Stadtrat beantragt dem Einwohnerrat erneut einen Verpflichtungskredit, um die Infrastruktur für Zweiräder an der Florastrasse zu erneuern. Im Oktober 2024 hatte der Einwohnerrat den entsprechenden Kredit zurückgewiesen. Neben den Kosten und nachgelieferten Informationen hatte das Parlament auch beanstandet, dass keine Alternativen aufgezeigt worden waren und dass das Projekt nicht in weitere Planungen rund um den Bahnhof Zofingen eingebettet worden sei.
Der Stadtrat beantragt dem Einwohnerrat einen Verpflichtungskredit von 640‘000 Franken. Der Bund beteiligt sich über den Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds mit 35 Prozent oder maximal 224‘000 Franken, wenn der Baustart bis Ende 2025 erfolgt. Vom Restbetrag übernimmt der Kanton die Hälfte. Somit verbleiben der Stadt Kosten in Höhe von 208‘000 Franken.
Wie bereits bei der Pfistergasse gab die FGPK im Vorfeld der Sitzung bekannt, dass sie das Geschäft ablehnt. Dieses Mal mit 6 zu 3 Stimmen.
Raphael Lerch spricht für die FGPK – und plaudert gleich freimütig Kommissionsgeheimnisse aus, bis ihn Einwohnerratspräsident Matthias Hostettler darauf hinweist. Man sei, so Lerch, in der FGPK überrascht gewesen, dass nach derart kurzer Zeit das Geschäft bereits wieder traktandiert wurde. In der Kommission sei eine «absurde Diskussion» entstanden. Dabei seien Zusammenhänge gemacht worden zum geplanten Entwicklungsschwerpunkt 16 des Kantons, der sich vom Zofinger Industriegebiet weiter nördlich nach Oftringen erstreckt. Ein Argument sei gewesen, dass es ein schlechtes Licht nach Aarau sendet, wenn man den Velounterstand ablehnt. Lerch findet, dass es bei diesem Geschäft hauptsächlich um die sehr hohen Kosten geht. Auch die Gelder von Kanton und Bund seien Steuergelder. Entsprechend sei die FGPK aus finanziellen Gründen gegen das Geschäft.
Lerch spricht direkt weiter für die SVP. Und in seinem Votum wird klar, was das Problem ist. «Der Zustand des Velounterstands ist eine Katastrophe», wettert er. «Dass man die Liegenschaft so herunterkommen liess, ist eine absolute Sauerei. Sie ist dunkel, ungepflegt und abweisend. Das Objekt ist der Stadt Zofingen unwürdig.» Seine ABklärung habe ergeben, dass der Velounterstand an der Florastrasse einmal pro Jahr gereinigt werden. «Es ist ein Trauerspiel an bester Lage», enerviert sich Lerch weiter und führt etliche weitere Mängel auf. Er stellt in der Folge den Antrag, die Sanierung für 50’000 Franken zu machen. Damit soll der Velokeller frisch gestrichen und die Beleuchtung ersetzt werden.
Ebenso einen Antrag reicht die GLP ein. Sie verlangt, dass die Sanierung mit 150’000 Franken erledigt wird. Christian Schnider führt aus, dass die Kosten das Killerkriterium seien. «Dass das Geld von Bund und Kanton kommen, macht es nicht besser.» Es seien fast 10’000 Franken pro neuem Veloabstellplatz, 1000 bis 1200 Franken seien normal.
Ebenfalls aufgrund der hohen Kosten gegen den Antrag des Stadtrats redet Michèle Graf von der Fraktion EVP-Die Mitte. «Das Vorhaben ist überdimensioniert», hält sie fest. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis bleibe schlecht. Sie ist der Meinung, dass der neu gebaute Velokeller über genügend Kapazitäten verfüge.
Uneinig ist sich hingegen die Fraktion FDP/ZM. Weil Zofingen eine Verkehrsdrehscheibe sei, stimme eine kleine Mehrzeit der Fraktion der Vorlage zu, führt Adrian Gaberthüel (FDP/ZM) aus. Grüne und SP hingegen stimmen der Vorlage des Stadtrats vollumfänglich zu. Die Förderung des Langsamverkehrs sei wichtig, betont Thomas Affentranger von den Grünen. Denn die Stadt wolle wachsen und eine Mobilitätsdrehscheibe sein, das gehe nur mit zukunftsfähiger Infrastruktur. Und SP-Sprecherin Salomé McNaught betont, dass die Westseite des Banhofs wichtig sei für die Gewerbezone. «Schon heute stellen Unternehmen ihren Mitarbeitenden Velos zur Verfügung.» Entsprechend brauche es genügend Veloabstellplätze.
Anschliessend nehmen gleich drei Stadträte Stellung. Vizestadtpräsident Andreas Rüegger als ehemaliger Ressortvorsteher, Robert Weishaupt als aktueller Ressortvorsteher und Finanzvorsteher Peter Siegrist. Dieser macht es kurz und sagt: «Finanziell können wir uns das leisten.» Rüegger hingegen führt die Vorgeschichte des Velokellers an der Florastrasse aus. Er konstatiert: «Was Sauberkeit und Ordnung betrifft, müssen wir – im wahrsten Sinne des Wortes – nachputzen.» Er weist zudem darauf hin, dass der aktuelle Velokeller Asbest enthalte. Nicht nur im Vordach, sondern eben auch in den Wandfugen. Weiter hätten sich auch Unternehmen dafür eingesetzt, dass es mehr Veloabstellplätze am Bahnhof gibt. Er weist zudem darauf hin, dass man künftig abgestraft werden könnte, wenn die Stadt eingeplante Agglogelder nicht nutzt.
Robert Weishaupt betont in der Folge, wie dringend der Bedarf an Veloabstellplätzen ist. Zudem fordere die SBB 1300 Veloparkplätze. Es kommt zu etlichen weiteren Voten für und gegen die Vorlage. «Es handelt sich um ein nachhaltiges Projekt, das auch eine Asbestsanierung beinhaltet. Wir hinterlassen unseren Nachkommen sonst einen asbestverseuchten Schandfleck», wirbt Stéphanie Szedlák von der Fraktion EVP-Die Mitte nochmals.
Nach der Detailberatung kommt werden die beiden Anträge von SVP und GLP einander gegenübergestellt. 15 zu 6 Stimmen resultieren für jenen der SVP. Er wird dem stadträtlichen Antrag gegenübergestellt, wobei dieser mit 22 zu 15 Stimmen obsiegt.
In der Schlussabstimmung kommt er ebenfalls durch – mit 23 zu 16 Stimmen. Nach hartem Ringen kann der Velokeller an der Florastrasse also saniert werden.
Mit Namensnennung: Einwohnerrat stimmt Antrag zu
Nach der Pause gehts ans Abstimmen über den Kredit zur Sanierung der Pfistergasse. Zuerst wird die geheime Abstimmung der Abstimmung per Namensnennung gegenübergestellt. Der Rat spricht sich für eine Abstimmung per Namensnennung aus mit 21 zu 17 Stimmen. Der Abstimmung per Namensnennung stimmt der Einwohnerrat dann mit 17:1 Stimme zu.
Der Einwohnerrat stimmt in der Schlussabstimmung dem stadträtlichen Antrag mit 20 zu 19 Stimmen zu.
Antrag auf Nichteintreten zur Vorlage Pfistergasse abgelehnt – Vorlage wird diskutiert
Im Juni 2024 hatte der Einwohnerrat einen Verpflichtungskredit für die Sanierung und Neugestaltung des südlichen Bereichs der Pfistergasse knapp abgelehnt. Der Ersatz der Werkleitungen und das Einlegen von Fernwärmeleitungen waren jedoch mehrheitlich unbestritten. Der Stadtrat nimmt deshalb heute Abend mit einer überarbeiteten Vorlage einen zweiten Anlauf und beantragt dem Einwohnerrat einen Verpflichtungskredit von 578‘000 Franken für die Sanierung und Aufwertung der Pfistergasse Süd.
Maik Müller (ZM) stellt Antrag auf Nichteintreten, da das Geschäft bei der letzten Diskussion im Einwohnerrat abgelehnt wurde – und nicht zurückgewiesen. Nun bringt der Stadtrat das gleiche Geschäft wieder mit nur minimalen Änderungen. «Da stellt sich schon die Frage, wie der Stadtrat mit demokratischen Entscheidungen umgeht», sagt er. Man könne nicht ein Geschäft so lange wieder traktandieren bis der Einwohnerrat ja sage.
An jener Sitzung im Juni habe der Einwohnerrat zwei Anträge zu behandeln gehabt, sagt Michael Wacker (SP). Einer, der für die Pflasterung, sei mit einer Stimme Unterschied abgelehnt, der andere, der für die Entwässerung, mit einer Stimme Unterschied, hingegen angenommen worden. Der gutgeheissene Antrag könne ohne den abgelehnten Antrag nicht ausgeführt werden. Wacker weist darauf hin, dass der neue Antrag nun rund 160’000 Franken günstiger sei als der damals abgelehnte Antrag. «Damals hat die FDP den Antrag gestellt, das Geschäft um 150’000 Franken zu kürzen.» Dieser Antrag wurde dann zurückgezogen. Er bitte darum, den Antrag auf Nichteintreten, abzulehnen. Ergänzend stellt Wacker den Antrag, über den Antrag auf Nichteintreten unter Namensaufruf abzustimmen.
René Schindler sagt, die SVP unterstütze den Nichteintretensentscheid der FDP.
Carla Fumagalli (GLP) sagt, sie sei auch kein Fan gewesen von der ersten Vorlage. Doch Kritik sei dafür da, umgesetzt zu werden. Und diese Kritik habe der Stadtrat nun umgesetzt. Der Stadtrat habe formal korrekt gehandelt und eine inhaltlich neue Vorlage vorgelegt.Yolanda Senn Ammann (Farbtupfer) wundert sich, dass die FDP den Antrag des Stadtrates nicht behandeln will, denn die FDP habe im Sommer eine Ersparnis von 150’000 Franken gefordert.
Tobias Hottiger (FDP) erklärt, dass die erste Vorlage zur Sanierung der Pfistergasse nicht zurückgewiesen, sondern abgelehnt worden sei. Bei einer Rückweisung könne das Geschäft nochmal traktandiert werden, bei einer Ablehnung sei das Geschäft aber vom Tisch.
Stadtrat Robert Weishaupt (Mitte) erkärt daran fest, dass der Stadtrat an der Vorlage festhalte. 160’000 Franken einzusparen, das sei nicht minimal. Daher bittet er, auf das Geschäft einzutreten.
Zuerst wird über den Antrag von Michael Wacker abgestimmt: Abstimmung unter Namensaufruf. Der Antrag wird angenommen mit 27 Ja zu 4 Nein angenommen. Somit erfolgt die Abstimmung über Nichteintreten per Namensnennung. Da der Einwohnerrat mit 20 zu 20 Stimmen über den Entscheid abstimmt, entscheidet Ratspräsident Matthias Hostettler mit Stichentscheid. Er lehnt den Antrag auf Nichteintreten ab.
Claudia Schürch (EVP) spricht für die FGPK. Kritikpunkt an der Vorlage sei, dass die beiden Vorlagen nicht gleich gerechnet worden seien und es somit schwierig ist, herauszulesen, was nun genau eingespart wurde. Es sei in der Kommission eine Meinungsfrage gewesen, ob man soviel in die Pflästerung investieren wolle oder nicht. Die Vorlage ist in der FGPK mit 5:4 Stimmen abgelehnt worden.
René Schindler spricht für die SVP. Für seine Fraktion sei klar, dass die Werkleitungen ersetzt werden müssten, doch es stehe nicht zur Diskussion, dass die Gasse neu gepflästert werde. Er verlangt, dass der Stadtrat den Entscheid des Einwohnerrats respektiert. Mit der Neupflästerung würden schon viele Stolperfallen beseitigt, so Schindler. Er kritisiert, dass der Stadtrat schon im Voraus Einsprachen von Procap befürchte und entsprechend handle. «Graben auf, Leitungen ersetzen, Graben zu, das reicht», so Schindlers Fazit.
Carla Fumagalli (GLP) sagt, der Einwohnerrat habe bei der letzten Diskussion des Geschäfts vieles diskutiert, oft sei der Begriff Luxusvariante gefallen. Mit der aktuellen Vorlage sei nun aber eine günstigere Variante geprüft und beantragt worden. Nach der Prüfung duch Procap könne nun der Mehrwert der behindertengerechten Pflästerung belegt werden. Die GLP-Fraktion ist der Meinung, dass man mit dem überarbeiteten Geschäft näher an eine begehbare Altstadt für alle komme. Es sei keine Luxusvariante – und als Pluspunkt werde im Bereich der Schifflände auch entsiegelt. Die GLP-Fraktion werde grossmehrheitlich zustimmen.
Andrea Plüss (EVP) spricht für die Fraktion EVP-Die Mitte. Sie sagt, das Postulat begehbare Altstadt für alle sei aus ihrer Fraktion eingereicht worden. Dabei sei aber auch Kostenneutralität gefordert worden. Ihre stimme die Fraktion teilweise zu, so Plüss.
Elisa Scheidegger (SP) sagt, die Altstadt Zofingen müsse für alle Menschen zugänglich sein. Eine behindertengerechte Pflästerung mache dies möglich, wie die Ringmauergasse zeige. Wenn der Einwohnerrat das Geschäft ablehnt, sei dies ein Nein zu einer begehbaren Altstadt für alle, so Scheidegger. Daher spricht die SP einstimmig dem stadträtlichen Antrag zu.
Alice Sommer (Güne) sagt, dass auch ihre Fraktion einstimmig dem stadträtlichen Antrag zustimmt. Auch sie ruft auf, eine begehbare Altstadt für alle zu schaffen. Jetzt darüber diskutieren, dass die Anpassung des Strassenraums zu viel kostet, sei menschenverachtend.
Béatrice Zinniker sagt, die Fraktion FDP/ZM sei nicht überzeugt von der Vorlage und werde sie daher ablehnen. Die Pfistergasse sei nicht stark frequentiert, da es dort kaum Ladengeschäfte gebe. Daher sei die Umgestaltung dieser Gasse nicht prioritär. Die Fraktion wolle niemanden ausschliessen, doch die Frage sei, ob diese Vorlage tatsächlich die erhofften Verbesserungen bringen werde. Aus Sicht der FDP/ZM-Fraktion ist die Pflasterung in der Pfistergasse recht gut erhalten. Daher sei es wichtig, die knappen Ressourcen der Stadt dort einzusetzen, wo möglichst viele Leute einen Nutzen davon haben.
Stadtrat Robert Weishaupt (Mitte) sagt, die Herausforderungen mit den Zugänglichkeiten und der Barrierefreiheit seien seit dem Entscheid im letzten Sommer nicht verschwunden. «Wir haben jetzt die einmalige Chance, die Pfistergasse zu verbessern.» Denn das StWZ müsse jetzt die Leitungen sanieren. «Ganz gratis gibt es nichts», mahnt Weisshaupt. Der Stadtrat orientiere sich am Konzept begehbare Altstadt für alle. Dass diese Barrierefreiheit nicht gratis zu haben sei, habe der Stadtrat schon vor Überweisung des Auftrags gesagt. Auf lange Frist fahre die Stadt besser mit qualitativ guten Lösungen, mahnt Weishaupt. Es sei im Interesses aller Zofinger, die Pfistergasse barrierefrei und attraktiv zu gestalten.
Yolanda Senn Ammann (Farbtupfer) will nicht anmassen zu beurteilen, welche Strassen wichtig sind und welche nicht. Doch: «Die Pfistergasse ist etwas wichtiger als die Rosmaringasse, die wir schon einmal als nicht wichtig eingestuft haben.» Sie ruft auf, die Gelegenheit zu nutzen und den Kredit für die behindertengerechte Pflästerung anzunehmen.
Michael Wacker (SP) erinnert, dass die Pfistergasse eine Gemeindestrasse ist wie die Wiesenstrasse, Weiherstrasse oder Rebbergstrasse. Diese werden regelmässig saniert und erneuert – nicht aufgewertet. Die Pfistergasse sei 1971 das letzte Mal saniert worden, mahnt Wacker. Und seither hätten sich nicht nur Normen geändert und auch die Verkehrsführung. «Da wären wir ja dumm, wenn wir die Chance nicht packen, wenn die StWZ die Gasse öffnet.»
André Kirchhofer (FDP) erlaubt sich eine Grundsatzbemerkung aus demokratiepolitischer Sicht: Politik sei ein Abwägen von Prioritäten. Und weil diese von Person zu Person und von Fraktion zu Fraktion unterschiedlich seien, könne man nicht sagen, welche Meinung richtig oder falsch sei. Das Votum «menschenverachtende Politik» sei gefallen. Als Präsident der FGPK betont Kirchhofer, dass niemand in der FGPK menschenverachtend sei. Es sei an der Zeit, dass man andere Meinungen zulasse, auch wenn sie nicht mit der eigenen Meinung übereinstimme.
Claudia Schürch (EVP) sagt, dass auch sie sich an der persönlichen und angriffigen Diskussion störe. Doch sie verweist auf das Behindertengleichstellungsgesetz, das festhält, dass keine Massnahmen umgesetzt werden müssen, wenn sie mehr als 20 Prozent Zusatzkosten verursachen. Nach ihrer Rechnung sind bei der Pfistergasse die 20 Prozent Mehrkosten knapp nicht erreicht. Daher ruft sie dazu auf, der Vorlage zuzustimmen. Auch wenn der Stadtrat auf Verlangen des Einwohnerrats ein Konzept zur Begehbarkeit der Altstadt geliefert hat, müsse man sich nicht zwingend an dieses Konzept halten. «Der Einwohnerrat wollte einfach mal wissen, wie man die Begehbarkeit umsetzen könnte», so Schürch.
Raphael Lerch (SVP) findet auch, dass man Wörter wie menschenverachtend nicht gelten lassen könne. Im Gespräch würden ihm die Leute immer wieder sagen, dass sie in die Altstadt kommen, auch wenn die Pflasterung nicht ganz eben sei.
Michèle Graf (Mitte) sagt, sie sehe den Handlungsbedarf von Seite StWZ, doch fühle sie sich hintergangen vom Stadtrat. Die Sanierung der Ringmauergasse sei nur mit extremen Mehrkosten möglich gewesen. Auch die Sanierung der Rosmaringasse sei teuer budgetiert worden. «Plötzlich jedoch war es möglich, die Gasse ohne grosse Mehrkosten zu pflastern.» Sie wünscht sich vom Stadtrat, das Unbehagen, im Einwohnerrat ernst zu nehmen und nicht die halbe Bevölkerung vor den Kopf zu stossen.
Franziska Kremer (SP) sagt, dass es doch nicht sein könne, dass der Einwohnerrat entscheide, welche Gassen mit Rollstuhl oder Kinderwagen befahren werden können und welche nicht. «Meine Prioritäten sind jetzt halt ganz klar bei den Menschen der Stadt Zofingen und nicht bei den Finanzen.»
Andrea Plüss (EVP) sagt, dass 168’000 Franken nötig sind, um die Gasse und den Schiffländeplatz aufzuwerten, da ja 250’000 Franken sowieso bezahlt werden müssen.
Raphael Lerch (SVP) möchte das Dokument sehen, wie definiert wird, wieviel die Stadt für Werkleitungssanierungen bezahlen muss.
Yolanda Senn Ammann (Farbtupfer) erinnert, dass die Diskussion heute Abend um rund 170’000 Franken Mehrkosten gehe.
Robert Weishaupt (Mitte) zitiert aus der Vereinbarung über Werkbauten im öffentlichen Raum. Umso älter eine Strasse sei, umso mehr müsse die Stadt an den Graben, der aufgerissen wird, bezahlen. Und weil die Pfistergasse 1971 das letzte Mal saniert wurde, muss die Stadt um die 250’000 Franken bezahlen.
Raphael Lerch (SVP) verlangt, dass diese Vereinbarung offengelegt wird, damit er nachvollziehen kann, wieviel die Stadt pro Gasse bezahlt bzw. bei künftigen Sanierungen bezahlen muss.
Maik Müller (ZM) stellt den Ordnungsantrag auf geheime Stimmabgabe. Damit möchte die Fraktion FDP/ZM allen Einwohnerräten die Möglichkeit geben, ihre Meinung ohne Druck von aussen zu äussern. Anderer Meinung ist Michael Wacker (SP). Die Verhandlungen des Einwohnerrats seien öffentlich. Daher will er die Abstimmung unter Namensaufruf durchführen.
Vor der Abstimmung gibt es eine Pause.
Einwohnerdienste erhalten neue Software
Die Software zur Führung des Einwohnerregisters soll durch eine zukunftsfähigere Lösung ersetzt werden. Der Stadtrat beantragt dem Einwohnerrat heute daher einen Kredit von 210‘000 Franken. Die aktuelle Software decke die Bedürfnisse der Einwohnerdienste nicht ab, hiess es im Vorfeld seitens Stadt. So würden notwendige Schnittstellen, beispielsweise zum Smart Service Portal des Kantons Aargau, fehlen. Das Einwohnerregister bildet die Grundlage für die Verwaltungsarbeit der Stadt und des Kantons. Ein Wechsel sei daher unumgänglich.
Anders Sjöberg (GLP) spricht für die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK). Er bezeichnet die aktuelle Software als Fehlinvestition, da diese erst 2020 eingeführt wurde. Wenn die Schnittstellen nicht funktionieren, komme es zu erheblichem Mehraufwand. Zudem seien mit dem aktuellen Anbieter keine Verbesserungen zu erwarten. Die FGPK empfiehlt die Annahme des Geschäfts einstimmig.
Dieser Empfehlung folgen die Fraktionen. Alle sprechen sich für den Kredit aus, äussern aber gleichzeitig auch das Bedauern, dass bereits nach fünf Jahren wieder eine neue Software nötig ist. Die Fraktionen sind sich aber einig, dass die Einwohnerdienste ein gutes Werkzeug brauchen, um effizient und gut zu arbeiten sowie den Datenschutz zu gewährleisten. Luc Zobrist von der Fraktion FDP/ZM hat aber zwei Kritikpunkte. Er will wissen, warum die IT-Abteilung nicht eingebunden wurde im Submissionsverfahren und warum man beim Eruieren der neuen Software eine externe Beratungsfirma hinzugezogen wurde.
Darauf entgegnet Stadtpräsidentin Christiane Guyer (Grüne), dass die IT-Abteilung bereits voll ausgelastet ist, weshalb ein externes Büro beigezogen wurde.
Nach einer kurzen Beratung stimmt der Rat dem Kredit für die neue Software zu.
Einbürgerungsgesuche genehmigt
Raphael Lerch (SVP) spricht für die Einbürgerungskommission: Die Kommission befürwortet alle vier Einbürgerungsgesuche. Der Rat genehmigt in der Folge die Einbürgerungen.
Flavio Wyss neuer Vizepräsident des Einwohnerrats
Nun stehen Wahlen an. Einerseits muss das Parlament einen neuen Vizepräsidenten oder eine neue Vizepräsidentin wählen, andererseits auch einen neuen Stimmenzähler oder eine neue Stimmenzählerin. Beide werden für den Rest der Amtsperiode 2024 bis 2025 gewählt.
Nach dem Wegzug des Vizepräsidenten Daniel Gygax, der den Wohnort gewechselt hat, portiert die FDP Flavio Wyss. Sein Parteikollege André Kirchhofer stellt Wyss den anwesenden Parlamentariern vor. Wyss sei seit 2023 im Rat, sei ruhig, besonnen, sachorientiert und argumentiere differenziert. Daher eigne er sich ideal als Vizepräsident. Wyss ist 33 Jahre alt, verheiratet und Vater einer kleinen Tochter. Beruflich ist er Verkaufsleiter und Mitinhaber einer Solarunternehmung. Privat ist er aktiv in der Feuerwehr Zofingen und bei den Handballern. Weitere Kandidaturen sind keine bekannt.
Die SVP nominiert als Ersatz für ihren Stimmenzähler Markus Gfeller Fabian Grossenbacher. «Er kann supergut zählen», scherzt der neue SVP-Fraktionspräsident Marco Negri.
Das Wahlbüro verschwindet in einen separaten Raum und zählt die Stimmen aus.
Wenig später gibt Einwohnerratspräsident Matthias Hostettler die Ergebnisse bekannt. Flavio Wyss wird mit 39 Stimmen gewählt, Fabian Grossenbacher mit 37 Stimmen.

Bild: zvg
Der Einwohnerrat ist vollständig anwesend
Der Ratspräsident kündigt an, dass es keine Abmeldungen gibt. Allerdings gibt bereits einen weiteren Rücktritt: Lena Hoffmann (Grüne) tritt per Ende Sitzung zurück. In ihrem Rücktrittschreiben sagt sie, dass sie ihre Aufgaben als Einwohnerrätin nicht mehr mit der dafür nötiger Zeit und Energie ausführe und sich daher für den Rücktritt entschlossen habe. Eingereicht wurden zwei Interpellationen von Michael Wacker (SP). Einmal zur Einspeisevergütung der StWZ und einmal zu den Auswirkungen der Abschaffung des Eigenmietwerts auf die Stadt Zofingen.
Vier neue Einwohnerräte in Pflicht genommen
Einwohnerratspräsident Matthias Hostettler begrüsst die Anwesenden. Gleich zu Beginn folgen die Inpflichtnahmen. Simon Anderegg (SP), Rainer Böni (FDP), Rahel Gassner (SVP) und Jürg Kast (Grüne) folgen auf die im vergangenen Jahr aus dem Rat zurückgetretenen Silan Kunz (SP), Daniel Gygax (FDP), Markus Gfeller (SVP) und Gian Guyer (Grüne). Sie stehen an nächster Stelle der Nichtgewählten ihrer Parteiliste für die Amtsperiode 2022 bis 2025 und rücken deshalb nach.
Sie werden heute Abend Inpflicht genommen:

Simon Anderegg, SP. – Bild: zvg 
Rainer Böni, FDP. – Bild: zvg 
Rahel Gassner-Ruf, SVP. – Bild: zvg 
Jürg Kast, Grüne. – Bild: zvg

Mehr Patrouillenzeiten, aber weniger häusliche Gewalt – Repol Zofingen zieht Bilanz übers Jahr 2024
Die Regionalpolizei Zofingen blickt in ihrem Jahresbericht 2024 nicht nur auf ihre Leistungen und erreichten Ziele zurück. Christiane Guyer, Stadtpräsidentin von Zofingen, ordnet das vergangene Jahr auch politisch ein: Der Grosse Rat habe auf die Vorzüge eines dualen Polizeisystems nicht verzichten wollen und sich daher für die Beibehaltung der Regionalpolizeien ausgesprochen. «Ein erfreulicher Entscheid für die Regionalpolizei Zofingen», so Guyer.
Patrouillen: neuer Höchststand
Besonders herausfordernd sei im vergangenen Jahr der Anstieg der Rechtshilfeersuchen von Behörden und Partnerorganisationen gewesen, sagt Polizeichef Stefan Wettstein. Sie stiegen um 19 Prozent auf 7392 Anfragen. Diese Entwicklung habe zu einem erheblichen Mehraufwand geführt.
Zurückgegangen sind die Einsätze bei häuslicher Gewalt. «Das ist ein positives Zeichen dafür, dass die präventiven Massnahmen wirksam sind», so Wettstein. Die Patrouillen leisteten 7915 Einsatzstunden (Vorjahr: 7069 Stunden) und erreichten damit einen neuen Höchststand.
Prävention und Aufklärung ein wichtiges Standbein
An Elternabenden informierte die Regionalpolizei über digitale Gefahren und gab Präventionstipps. Die Veranstaltungen seien auf positive Resonanz gestossen und hätten das Sicherheitsbewusstsein in den Familien gestärkt, so die Regionalpolizei.
Auch 2025 wird die Regionalpolizei auf Aufklärung und Prävention setzen – in ihren Jahreszielen hat sie sich vorgenommen, sich an mindestens zwei nationalen polizeilichen Präventionskampagnen zu beteiligen. Weitere Jahresziele fürs Jahr 2025 sind unter anderem die Verbesserung und Erhöhung der Schulwegsicherheit mit Präventionsmassnahmen sowie die Beschaffung und Nutzung des «Taser 10».
Mit Ausnahme der Prüfung der Einsatz- und Schichtzeiten hat die Repol 2024 ihre Jahresziele erreicht. Dazu gehört unter anderem die Organisation von mindestens vier Präventionskampagnen, mindestens zwölf Aktionen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit – auch im Zusammenhang mit der Schulwegsicherheit – und die Einführung von Ordnungsbussenblöcken mit QR-Code. So können Fahrzeuglenkende die Details ihrer Busse digital abrufen. Das steigere die Effizienz und verbessere den Datenschutz, so die Repol. Zusätzlich wurden Bezahlmöglichkeiten wie Twint und Kreditkarte eingeführt.
Zusätzlich zu den Sicherheitskampagnen im Strassenverkehr setzt die Regionalpolizei neu auf die E-SpeedControl-Prüfrolle, wie sie mitteilt. Damit können vor Ort die Höchstgeschwindigkeiten von Trendfahrzeugen wie E-Scootern und E-Rollern gemessen werden. Im Jahr 2024 wurden sechs manipulierte Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen – das schnellste davon fuhr mit 88 km/h statt der erlaubten 20 km/h.
Jahresrechnung schliesst mit Plus – Personalkosten waren geringer
Die Jahresrechnung 2024 schliesst mit einem positiven Ergebnis von 628’700 Franken ab. Grund dafür sind unter anderem die Personalkosten, die aufgrund von vorübergehenden Vakanzen 607’036 Franken tiefer liegen als budgetiert. Im Jahr 2024 sind vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Repol ausgeschieden, zwei neue dazugekommen. Somit liegt der Personalbestand Ende Jahr bei 48 Personen und einem Polizeihund, was den Sollbestand nicht ganz deckt. Da ein Platz an der Polizeischule nicht besetzt wurde und von ausgeschiedenen Mitarbeitern Ausbildungsbeiträge zurückbezahlt werden mussten, ist der Aufwand im Konto Aus- und Weiterbildung 145’000 Franken unter dem Budget. Der Bruttoaufwand pro Vollzeitstelle liegt bei knapp 160’000 Franken und entspricht den Vorjahren. (lbr/pd)

Nistende Tauben sorgen für Ärger bei den Pendlern und für schmutzige Velos

Kandidatur oder nicht? So haben sich die amtierenden Stadträte entschieden

«Das Ergebnis der Stadt Aarburg verschlechtert sich massiv» – so kontert die FDP nach der Infoveranstaltung zum Budget
Nach der Infoveranstaltung vom Donnerstag zum Budget 2025 hält die FDP Aarburg – sie hat erfolgreich das Referendum ergriffen – an ihren Hauptkritikpunkten fest. «Das Ergebnis der Stadt Aarburg verschlechtert sich massiv», hält die Partei fest. Sie kritisiert, dass die Kosten im Vergleich zur Rechnung 2023 um 11 Prozent steigen – «und dies ohne grössere Vorkommnisse».
Besonders stossend findet die FDP den Anstieg bei den Personalkosten. Diese steigen von 7,618 (Rechnung 2023) auf 8,774 Millionen Franken. Das entspricht Mehrausgaben von 1,156 Millionen Franken – «auch wenn Hans-Ulrich Schär das mit Einsparungen bei den Betriebskosten gegenrechnet und nur 721‘756 Franken nennt», wie die Partei festhält. Umso erstaunlicher sei es, dass letztere ebenfalls markant ansteigen.
Die Mehrausgaben hätten kaum einen Mehrwert für das Volk. Es gehe nicht nur darum, Zahlen zu erklären. «Wir müssen die Kosten in den Griff kriegen und gegensteuern», schreibt die FDP-Ortspartei. Bezüglich Steuerfuss sei man noch immer im hintersten Viertel des Kantons. «Und ohne Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds wäre das Ergebnis des Budgets 2025 sogar negativ.» Trotz Mehreinnahmen bei den Steuern von 1,4 Millionen Franken resultiere ein Ertragsrückgang von 1,7 Millionen Franken. «Das ist dramatisch», findet die Partei. Die FGPK habe zudem vor einem Schuldenanstieg gewarnt. «Der Stadtrat verkennt die sich verschlechternde Situation und vermittelt eine falsche Sicherheit», schreibt die FDP. Es gehe nicht, künftigen Generationen eine Bürde aufzuladen.
Unfair behandelt fühlt sich die FDP nicht zuletzt auch, weil ihre Stellungnahme in den Unterlagen zur Urnenabstimmung vom 30. März kleiner abgedruckt wurde als die Texte des Stadtrats.

Ein überraschender Punkt zum Saisonauftakt – Wiggertal unterliegt erst in der Verlängerung

Aus für Geburtenstationen in Menziken, Rothrist und Muri – jetzt redet Hebamme und Grossrätin Barbara Stocker

Reiden macht satten Gewinn: Überschuss beträgt 3,6 Millionen Franken