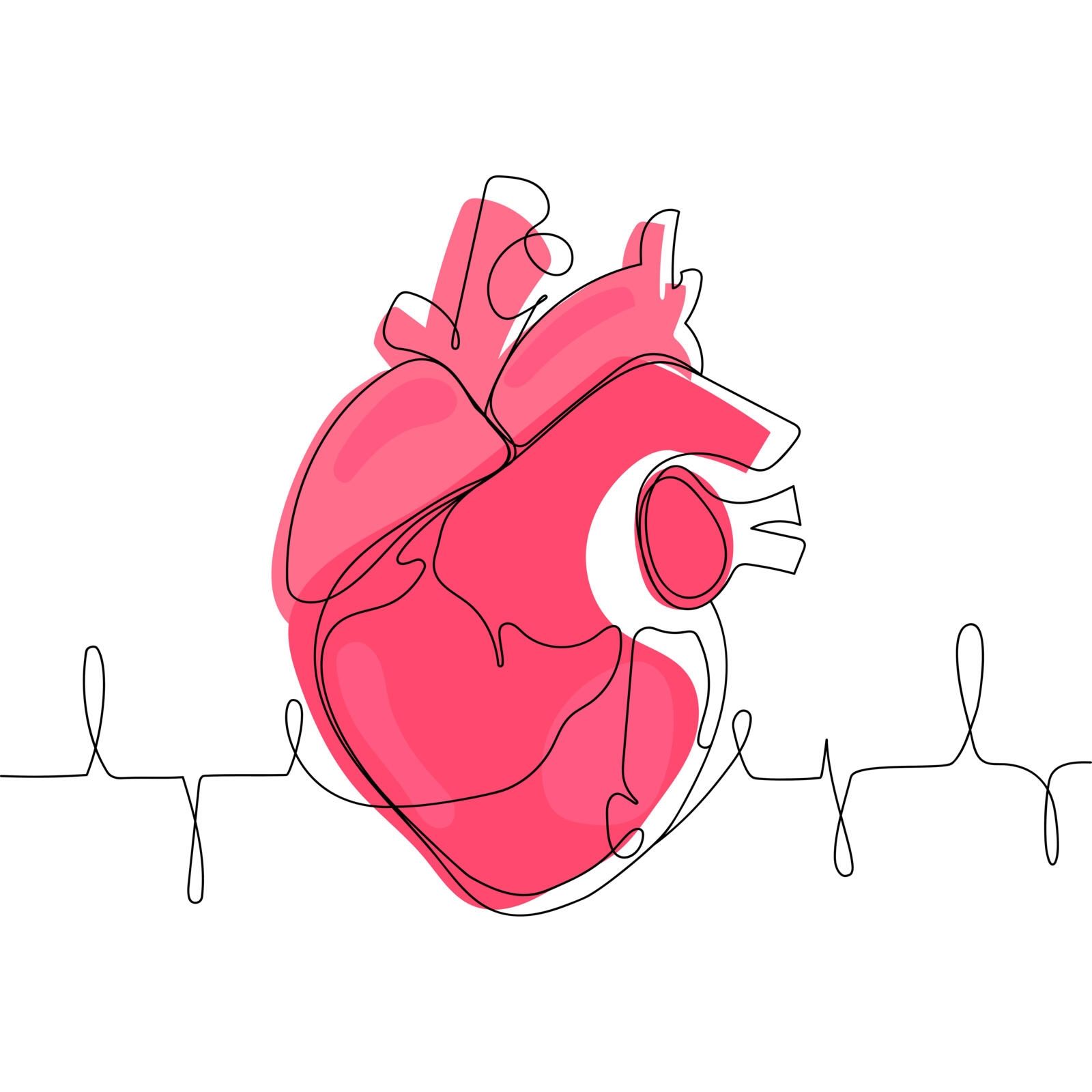Blick hinter die Kulissen des Notfalls
«Bei Schmerzen in der Brust, Atemnot, ungewohnten starken Schmerzen, Lähmungen, Sprach- oder Bewusstseinsstörungen, starken Blutungen aus Körperöffnungen oder durch eine Verletzung sollte unverzüglich der Notfall aufgesucht werden», sagt Dr. med. Rico Fiumefreddo, Leitender Arzt Notfallmedizin und stellvertretender Chefarzt Innere Medizin am Spital Zofingen. Hingegen könne bei länger bestehenden Beschwerden, einem Schnupfen mit Husten und Fieber oder einem Insektenstich auch abgewartet oder Rat in einer Apotheke geholt werden. Eine allgemeingültige Regel gibt es jedoch nicht. Hinter einigen harmlosen Symptomen können lebensbedrohliche Erkrankungen stecken. Können, aber müssen nicht. Ob schlussendlich ein Notfall ein Notfall ist, stellt sich nicht selten nach der Abklärung heraus.
Schwere Fälle werden prioritär behandelt
Auf der Notfallstation wird als Erstes von einer spezialisierten Pflegefachperson eine Erstbeurteilung vorgenommen. Diese wird mittels eines standardisierten Verfahrens durchgeführt, bei dem die Symptome und der körperliche Zustand beurteilt werden. Aufgrund dieser Beurteilung wird über die Behandlungspriorität entschieden. Diese Triage bestimmt, ob unverzüglich weitere, lebenswichtige Massnahmen zu treffen sind oder ob mit der ärztlichen Behandlung zugewartet werden kann. Je nach Dringlichkeit kann es zu Wartezeiten kommen. Als Erstes müssen die lebensbedrohlichen Fälle behandelt werden, wie etwa ein Schlaganfall, Herzinfarkt, Lungenversagen oder schwerwiegende Verletzungen. Nicht immer stösst das bei Patientinnen und Patienten mit harmloseren Verletzungen oder Beschwerden auf Verständnis, wenn sie davon ausgehen, dass man der Reihe nach behandelt wird. «Notfälle sind leider nicht planbar. Wartezeiten sind unvermeidbar, insbesondere bei hohem Patientenaufkommen. Wir sind bestrebt, diese so kurz wie möglich zu halten. Häufig sind die Gesündesten die Unzufriedensten», sagt er.
Fallzahlen auf dem Notfall steigen
Rund um die Uhr werden täglich 40 bis 50 Notfälle behandelt, was mit einem jährlichen Anstieg von 2–5% rund 18’000 Fälle pro Jahr ausmacht. Am späteren Morgen und späteren Nachmittag treffen am meisten Patientinnen und Patienten ein. An den Wochenenden und an Feiertagen steigen die Patientenzahlen, dies dürfte mitunter daran liegen, dass die Hausarztpraxen geschlossen sind. Weitere Gründe für ein Ansteigen seien etwa die demografische Entwicklung sowie ein zunehmender Mangel an Hausarztpraxen. «Ausserdem wenden sich Menschen an uns, die im Internet nach Antworten auf ihre Beschwerden gesucht haben. Was sie lesen, verunsichert sie.» Die Notfallstation besteht aus unterschiedlichen Behandlungszonen. Ein Bereich besteht aus zehn Liegeplätzen, sechs davon mit Monitorüberwachung. In einem weiteren Bereich gibt es ein Behandlungszimmer mit Sitzplätzen. Zusätzlich verfügt sie über ein spezialisiertes Zimmer für die Wundversorgung, ein Gipszimmer und einen Schockraum, in dem Schwerstkranke versorgt werden. Rund 20 Mitarbeitende gehören zum Pflegeteam der Notfallstation, dazu Fachärzte und Assistenzärzte. «Für die Notfallpflege, Chirurgie und Innere Medizin sind wir eine Weiterbildungsstätte.»
144 rufen oder sich privat hinfahren lassen?
Wer etwa unter Lähmungserscheinungen oder Bewusstseinsstörungen leidet, akute Schmerzen in der Brust oder Atemnot verspürt, nach einem Unfall nicht mehr gehen kann oder stark blutet, sollte den Rettungsdienst rufen. Wer hingegen nach einem Sturz den Fuss nicht mehr belasten kann, darf sich von Angehörigen oder Bekannten chauffieren lassen. Hier sei auch die Eigenverantwortung gefordert, sagt Dr. Fiumefreddo. Idealerweise und sofern die Zeit es erlaubt, nimmt man die Krankenkassenkarte, die Medikamentenliste und falls vorhanden und griffbereit einen aktuellen Arztbericht mit.
Kindheitstraum hat sich erfüllt
«Einmal Arzt zu werden und auf dem Notfall zu arbeiten, das habe ich mir als Fünfjähriger gewünscht, als ich selbst ein Notfall war», erinnert sich der Mediziner. Durch dieses Erlebnis wurde die Leidenschaft für die Medizin geweckt. Seit März 2025 arbeitet er am Spital Zofingen. Zuvor war er 15 Jahre lang am Kantonsspital Aarau auf der Inneren Medizin und Notfallstation tätig. An seiner Tätigkeit reizt Dr. Fiumefreddo das breite Spektrum an Notfällen und der einzelne Mensch, der dahintersteckt. «Die Medizin ist ein Überraschungsei, das macht die Arbeit abwechslungsreich und spannend zugleich.» Zudem sei es ein gutes Gefühl, wenn man sähe, dass man helfen konnte. Was in den meisten Fällen gelinge.
Spital Zofingen – nach wie vor ein Spital für alle
Seit letztem Dezember gehört das Spital Zofingen zu Swiss Medical Network. Obwohl nun zugehörig zu einer eine Privatklinikgruppe, bleibt das Spital weiterhin öffentlich zugänglich für alle Versicherungsklassen und wird keine Privatklinik. Für Patienten ändert sich nichts
Interview: Carolin Frei

Bild: zvg
Swiss Medical Network betreibt 21 Kliniken und Spitäler sowie über 70 ambulante Zentren in allen grossen Sprachregionen der Schweiz. Dank diesem Netzwerk und dem Zugang zu Hochleistungstechnologien wird die Position des Spitals Zofingen gestärkt und die Versorgungsqualität für Patientinnen und Patienten gesichert.
Noch immer kursieren Gerüchte, wonach das Spital Zofingen nun eine Privatklinik sei. Wie lässt sich so was entkräften?
Olivera Ceric, Direktorin des Spitals Zofingen: Wir nehmen diese Gerüchte sehr ernst. Es ist uns wichtig, klar zu kommunizieren: Das Spital Zofingen ist und bleibt ein Haus für alle. Unsere Türen stehen allen Versicherten offen – unabhängig von Versicherungsmodell oder Status. Mit der Übernahme hat sich für unsere Patientinnen und Patienten nichts geändert: Wir bleiben der zuverlässige Grundversorger in der Region. Zudem pflegen wir weiterhin unsere bewährten Partnerschaften mit Altersheimen und anderen Institutionen, um eine integrierte, bedarfsgerechte Versorgung zu gewährleisten.
Sie bleiben Grundversorger –
auch künftig mit dem bestehenden Dienstleistungs-Portfolio?
Ja, unser gesamtes medizinisches Leistungsangebot bleibt bestehen. Wir bieten weiterhin alle relevanten Dienstleistungen an – von der Allgemeinen Medizin über Chirurgie, Orthopädie und Kardiologie bis hin zu Altersmedizin und Palliative Care. Besonders wichtig ist uns der Notfallbereich: Wir betreiben einen 24/7-Notfalldienst und sind damit jederzeit für unsere Patientinnen und Patienten da – rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. Neben unserem breiten Angebot legen wir grossen Wert auf einen hohen Qualitätsstandard, von dem alle Generationen profitieren. Wir modernisieren gezielt einzelne Abteilungen, beispielsweise die OP-Säle und den Notfallbereich, und treiben die Digitalisierung voran, um insbesondere im ambulanten Bereich noch effizienter zu werden. Unsere Patienten stehen für uns im Mittelpunkt. Und auch das Kantonsspital Aarau bleibt für uns ein zentraler Partner, mit dem wir auch künftig eng und zielorientiert zusammenarbeiten werden.
Wie geht es weiter mit dem Spital
Zofingen, gibt es eine neue Strategie?
Unsere neue Strategie ist eindeutig: Wir bleiben der zuverlässige Grundversorger für die Region – das ist und bleibt unsere Kernaufgabe. Gleichzeitig intensivieren wir die Zusammenarbeit mit unserem Pflegezentrum sowie mit der Privatklinik Villa im Park, die beide ebenfalls zu Swiss Medical Network gehören.
Wie darf man sich diesen Ausbau der Zusammenarbeit vorstellen?
Besonders wichtig ist uns dabei, Synergien zu nutzen – etwa durch einen gemeinsamen Mitarbeitendenpool über die Standorte hinweg. Im Mittelpunkt steht für uns das Modell der integrierten Versorgung. Wir setzen darauf, die medizinische und pflegerische Versorgung unserer Patientinnen und Patienten entlang der gesamten Versorgungskette noch enger zu verzahnen. Dies tun wir sowohl mit internen als auch mit externen Partnern. Der Leistungsauftrag des Kantons für die Innere Medizin bleibt unverändert – sowohl stationär als auch ambulant. Keine bisherigen Fachbereiche oder Leistungen fallen weg. Im Gegenteil: Wir bauen die Altersmedizin und die Innere Medizin weiter aus.