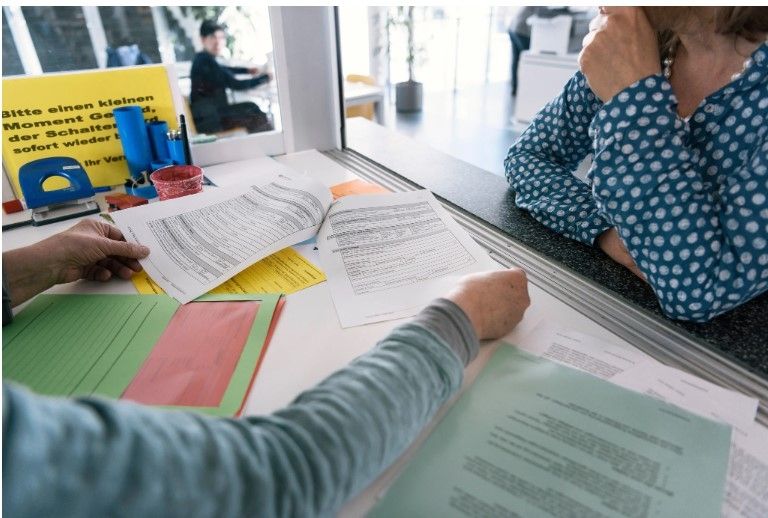Integration von Geflüchteten in den Aargauer Arbeitsmarkt: Podium der Caritas über Hürden und Lösungen
Jenen Menschen eine Stimme geben, die keine Lobby haben: Das machte die Caritas Aargau zum Ziel eines Abends mit Fachreferaten und einer Podiumsdiskussion, die sich um Chancen von Geflüchteten im Arbeitsmarkt drehten. In Zeiten grosser Herausforderungen sei es wichtig, mit solchen Anlässen den Austausch und die Zusammenarbeit zu fördern, sagte Elisabeth Burgener, Präsidentin der Caritas, zu Beginn des Abends.
Das Einstiegsreferat hielt Michael Siegenthaler, Leiter des Forschungsbereichs Schweizer Arbeitsmarkt der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Wie die Caritas in einer Mitteilung schreibt, legte Siegenthaler dar, dass die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten in der Schweiz gegenüber vergleichbaren Ländern schleppend verläuft und nur wenige Flüchtlinge in den ersten Jahren eine Stelle finden. Unter anderem argumentierte er, dass sich das Arbeitsverbot für Geflüchtete langfristig negativ auf die Integration auswirkt. Gleichzeitig bringen die Verbote kaum Nutzen für den restlichen Arbeitsmarkt.
Sibel Karadas, Leiterin der Sektion Integration und Beratung des Amtes für Migration und Integration beim Kanton, nahm eine Standortbestimmung für den Aargau vor. Anhand von Statistiken und Analysen zeigte sie, wie sich der Kanton in der Arbeitsmarktintegration weiterentwickelt. Man fokussiere darauf, Geflüchtete langfristig von der Sozialhilfe zu lösen. Im Vergleich zu anderen Kantonen stehe der Aargau gut da.
Herausforderungen in der Podiumsdiskussion
Im Anschluss startete das Podium. Moderatorin Anne Käthi Kremer begrüsste neben Michael Siegenthaler und Sibel Karadas die Grünen-Nationalrätin Irène Kälin, Präsidentin des Gewerkschafts-Dachverbands Arbeit Aargau, und den Unternehmer Marco Tschudin, Vorstandsmitglied der Aargauischen Industrie- und Handelskammer.
Sind die politischen Hürden bei der Anerkennung von Qualifikationen zu hoch? Diese Frage richtete sich zunächst an Irène Kälin. «Ja», sagte sie, auch wenn die politische Mehrheit dies anders sehe. Es gebe zwar messbare Erfolge, aber die Sparmassnahmen, welche der Bundesrat derzeit diskutiere, könnten einen Rückschritt bedeuten. Kälin wünscht sich, dass die seit 2019 ausbezahlte Pauschale von 18’000 Franken pro Person erhöht werde. Das ermögliche eine schnellere und nachhaltigere Integration und vermeide Folgekosten in der Sozialhilfe.
Auf die Frage, warum die Arbeitsmarktintegration in der Schweiz langsamer verlaufe als in vergleichbaren Ländern, sagte Michael Siegenthaler: «Die Schweiz hat lange Zeit einen sehr zurückhaltenden Ansatz bei der Integration verfolgt.» Andere Länder hätten früher begonnen, diese zu fördern. Mit der niedrigen Arbeitslosigkeit und dem integrativen Arbeitsmarkt habe die Schweiz aber eine gute Ausgangslage, um Geflüchtete erfolgreich zu integrieren.
Unternehmer Marco Tschudin schilderte Erfahrungen aus dem Alltag seines Architekturbüros, in dem Mitarbeitende mit unterschiedlichen Nationalitäten tätig sind. Es sei zwar mit zusätzlicher Bürokratie verbunden, Personen mit verschiedenem Aufenthaltsstatus einzustellen. Für ihn überwögen jedoch die Vorteile, die die Vielfalt der Menschen in den Betrieb einbringe. Dennoch würde er es begrüssen, wenn die Prozesse vereinfacht würden.
Es sei wichtig, dass Unternehmer informiert, sensibilisiert und unterstützt würden, sagte Sibel Karadas. Sie verwies auf die Kontaktstelle Integration Arbeitsmarkt, die Anfragen von Unternehmen direkt beantworte, sodass keine eigenen Recherchen nötig seien. Diese Massnahme sei ein guter Ansatz, sei derzeit aber noch zu wenig etabliert und sollte bekannter gemacht werden. (lil)