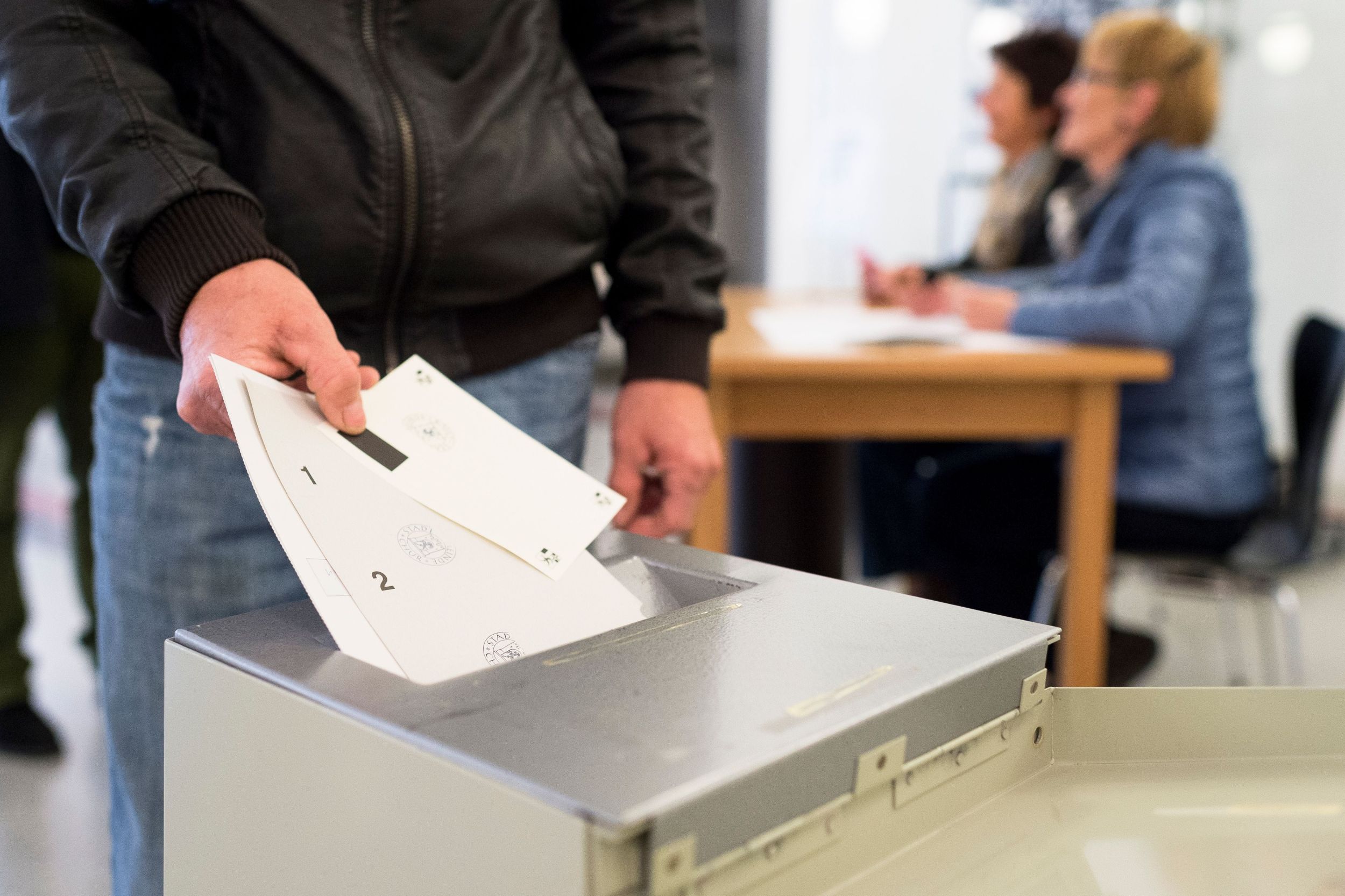
Neue EU-Verträge: Müssen Volk und Kantone zustimmen?
Die neuen Verträge und die Umsetzungsgesetzgebung befinden sich zurzeit in der Vernehmlassung. Der Bundesrat und die Europäische Kommission beabsichtigen, die neuen Verträge im Frühjahr 2026 zu unterzeichnen. Danach folgt die Ratifizierung in der EU und der Schweiz.
Zustimmung in der EU
In der EU müssen der Rat und das Europäische Parlament dem Abschluss zustimmen. Spezielle Aufmerksamkeit verdient das Freizügigkeitsabkommen. Dieses Abkommen ist ein gemischtes Abkommen: Vertragsparteien sind nicht nur die EU und die Schweiz, sondern auch alle Mitgliedstaaten. Es ist offen, ob die geplanten Neuerungen nun auch von allen Mitgliedstaaten ratifiziert werden müssen.

Serie zu den neuen EU-Verträgen
Matthias Oesch ist Professor für Europarecht an der Universität Zürich. In einer Serie beleuchtet er für CH Media die wichtigsten Aspekte zum Paket der neuen Verträge mit der EU, das der Bundesrat in die Vernehmlassung geschickt hat.
Zustimmung in der Schweiz
In der Schweiz muss die Bundesversammlung die Verträge genehmigen und die Umsetzungsgesetzgebung verabschieden. Der Bundesrat schlägt vor, das Vertragspaket zu diesem Zweck aufzuteilen: Die Änderungen der bestehenden Abkommen, die Kohäsionszahlungen und das Abkommen zu den Programmbeteiligungen der Schweiz etwa bei der Forschung gehören zusammen (Stabilisierung). Die neuen Abkommen zum Strom, zur Gesundheit und zur Lebensmittelsicherheit werden separat behandelt (Weiterentwicklung). Klar ist, dass die neuen Abkommen nur in Kraft treten können, wenn der Stabilisierungsteil akzeptiert wird.
Staatsvertragsreferendum
Die Bundesversammlung entscheidet, ob die Verträge dem fakultativen Referendum unterstellt werden, womit das Volksmehr genügen würde. Oder ob für den Stabilisierungsteil das obligatorische Referendum zum Zug kommt, womit auch die Mehrheit der Kantone zustimmen müssten.
Die Bundesverfassung sieht nur bei einem EU- oder NATO-Beitritt ausdrücklich ein obligatorisches Referendum vor. Es ist umstritten, ob die Bundesversammlung darüber hinaus auch ein obligatorisches Referendum anordnen kann, wenn ein völkerrechtlicher Vertrag die verfassungsmässige Ordnung tangiert oder eine grundlegende Neuorientierung der Aussenpolitik bewirkt.
Die Bundesverfassung sieht nur bei einem EU- oder Nato-Beitritt ausdrücklich ein obligatorisches Referendum vor. Es ist umstritten, ob die Bundesversammlung darüber hinaus auch ein obligatorisches Referendum anordnen kann, wenn ein völkerrechtlicher Vertrag die verfassungsmässige Ordnung tangiert oder eine grundlegende Neuorientierung der Aussenpolitik bewirkt.

Frank Bruederli / zvg
Der Bundesrat bejaht dies. Er kommt aber zum Schluss, dass die neuen Verträge die verfassungsmässige Ordnung nicht tangieren und auch keine grundlegende Neuorientierung der Aussenpolitik bewirken. Folgerichtig schlägt er vor, die Verträge dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Gute Gründe sprechen für dieses Vorgehen. Ein ausserordentliches Referendum sollte nur in einem eindeutigen Fall angeordnet werden. Ein solcher liegt hier kaum vor.
Sofern sich die Bundesversammlung für ein obligatorisches Referendum entscheidet, mag das erforderliche Ständemehr durchaus das Zünglein an der Waage spielen. Bei den Schengen/Dublin-Abkommen über die Zusammenarbeit im Polizei- und Asylbereich war die Bundesversammlung der Ansicht, dass kein Anwendungsfall für ein ausserordentliches Referendum vorlag. In der Folge stimmte 2005 eine Mehrheit des Volkes für die beiden Abkommen (54,6 Prozent), während eine Mehrheit der Kantone dagegen war (10 Kantone und 4 Halbkantone). Beide Abkommen wären somit am Ständemehr gescheitert. Das Volksmehr genügte für das Inkrafttreten.
Verfassungsänderung
Die Bundesversammlung kann die Zustimmung zu den Verträgen von der Annahme einer neuen Verfassungsbestimmung abhängig machen. Eine solche Bestimmung könnte die Ziele der Schweizer Europapolitik umreissen und den Bundesrat ermächtigen, die Verträge zu ratifizieren. Damit käme das ordentliche Verfahren zur Änderung der Bundesverfassung zum Zug, womit ein doppeltes Mehr von Volk und Ständen erforderlich wäre.
Dieser Weg wurde beim Beitritt der Schweiz zur Uno 2002 gewählt. Die damalige Verfassungsänderung wurde allerdings durch eine Volksinitiative initiiert und ging nicht von der Bundesversammlung aus.
Kompass-Initiative
Mehrere Volksinitiativen, welche sich im Sammelstadium befinden oder bereits zustande gekommen sind, thematisieren das Verhältnis der Schweiz zur EU. Dazu gehört auch die Volksinitiative «Für eine direktdemokratische und wettbewerbsfähige Schweiz – keine EU-Passivmitgliedschaft (Kompass-Initiative)».
Diese Initiative fordert für den Abschluss von völkerrechtlichen Verträgen, die eine Übernahme wichtiger rechtsetzender Bestimmungen vorsehen, die Zustimmung von Volk und Ständen. Sie ist zwar allgemein formuliert, zielt aber offenkundig gegen den Abschluss der neuen Verträge mit der EU. Unter Umständen müsste die Abstimmung über die neuen Verträge gar nochmals wiederholt werden.
Dies verlangt eine rechtsstaatlich problematische Rückwirkungsklausel der Initiative, wenn die neuen Verträge vor der Annahme der Initiative im Rahmen eines fakultativen Referendums nur vom Volk angenommen würden. Gleichwohl wäre es nicht sachgerecht, die neuen Verträge nur aus diesem Grund von Anfang an Volk und Ständen zu unterbreiten.
Auf dem Prüfstand
Die Schweiz steht vor einem wegweisenden Entscheid. Ist sie bereit, das bilaterale Vertragswerk auf eine neue institutionelle Grundlage zu stellen und auszubauen? Oder ist der damit einhergehende Integrationsschritt ein zu grosser, und es folgt eine Phase der Entfremdung von der EU und eine Ära der Unsicherheit – mit ungewissem Ausgang?





