
Volksmehr oder Ständemehr bei den EU-Verträgen? Aargauer Staatsrechtler hat eine klare Meinung
Der Grosse Rat des Kantons Aargau soll mit einer Standesinitiative die Bundesversammlung auffordern, die Abstimmung über die EU-Verträge dem obligatorischen Referendum zu unterstellen und damit auch den Ständen eine Stimme zu geben.Eine knappe Mehrheit des Rates stimmte diesem Antrag der SVP zu und sprach sich dafür aus, eine solche Initiative auszuarbeiten.Als Begründung führte die Sprecherin der SVP an, die neuen Verträge mit der EU hätten Auswirkungen auf die Kantone. Eine breite demokratische Legitimierung sei deshalb nötig und fördere die Akzeptanz beim Volk. Diese Begründung ist nach meiner Ansicht nicht zutreffend.
Dass für die Annahme bestimmter Vorlagen nicht nur ein Volksmehr, also eine Mehrheit der Abstimmenden, notwendig ist, sondern zusätzlich ein Ständemehr, also eine Mehrheit von Kantonen, in welchen die Vorlage angenommen wird, dient dem Schutz der kleinen Kantone vor den grossen: Sie sollen bei Entscheidungen, die für die Kantone besonders wichtig sind (z. B. Verfassungsänderungen), nicht immer von den grossen überstimmt werden. Das führt dazu, dass die Stimmkraft der Abstimmenden in den kleinen Kantonen viel grösser ist als in den bevölkerungsreichen.
Ständemehr hat nichts mit demokratischer Legitimation zu tun
Das Ständemehr ist eine Form des Minderheitenschutzes und hat nichts mit der demokratischen Legitimation zu tun. Man könnte sogar sagen, dass das Erfordernis des Ständemehrs «undemokratisch» ist, weil es zu einer Ungleichbehandlung der Stimmberechtigten in den Kantonen führt. Es fördert auch nicht die Akzeptanz, im Gegenteil: Wenn eine Mehrheit des Volkes eine Vorlage annimmt, diese aber wegen des fehlenden Ständemehrs scheitert, sind die zustimmenden Stimmberechtigten frustriert.
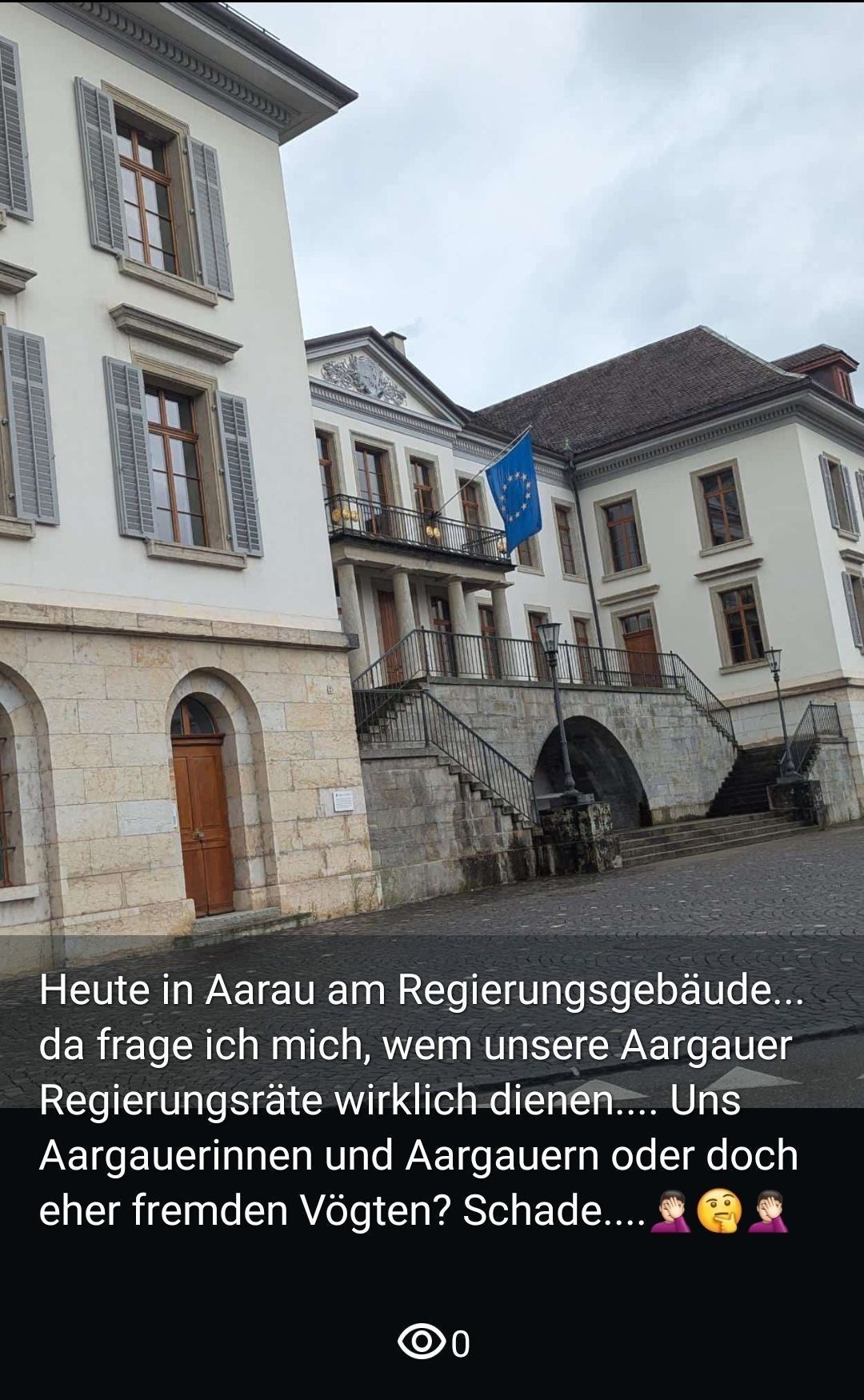
Bild: Christoph Hagenbuch / Facebook
Im Übrigen ist umstritten, ob die Abstimmung über die EU-Verträge dem obligatorischen Referendum (mit Ständemehr) untersteht oder nicht. Die Bundesverfassung sieht in Art. 140 Abs. 1 lit. b das Obligatorium bei Staatsverträgen nur in zwei Fällen vor, nämlich für den Beitritt zu Organisationen für kollektive Sicherheit (z. B. Nato) oder zu supranationalen Gemeinschaften (z. B. EU). Beides trifft offensichtlich nicht zu. Es fragt sich, ob diese Aufzählung abschliessend ist oder nicht.
Eine Minderheit der Lehre nimmt an, die Bundesversammlung sei befugt, darüber hinaus auch bei besonders wichtigen Staatsverträgen mit «verfassungsmässigem Charakter» ein obligatorisches Referendum (mit Ständemehr) anzuordnen. Diese Lehrmeinung beruft sich auf ungeschriebenes Verfassungsrecht und die (uneinheitliche) Praxis von Bundesrat und Bundesversammlung.
Abstimmungen nach Vorschriften der Verfassung
Ich teile die Auffassung der Mehrheit der Lehre, des Bundesamtes für Justiz und des Bundesrates, dass Volksabstimmungen nach den Vorschriften der Verfassung und nicht, wie z. B. in Frankreich, nach Belieben von einem Staatsorgan bei «wichtigen» Verträgen angeordnet werden können. Die Aufzählung in der Verfassung ist abschliessend. Dafür spricht auch, dass Ständerat Andrea Caroni mit seiner Motion vom 15. Januar 2020 forderte, dass völkerrechtliche Staatsverträge mit verfassungsrechtlichem Charakter dem obligatorischen Referendum unterstellt werden sollten.
Die Motion wurde von beiden Räten gutgeheissen. Der Bundesrat unterbreitete dem Parlament einen Vorschlag für eine entsprechende Verfassungsänderung. Die Mehrheit des Nationalrates hielt eine Änderung nicht für nötig, insbesondere weil sie kein Demokratiedefizit beseitige, sondern eine Ausweitung des Ständemehrs für die Annahme von bestimmten Staatsverträgen bringe, obwohl die Kantone von ihnen kaum betroffen seien.





