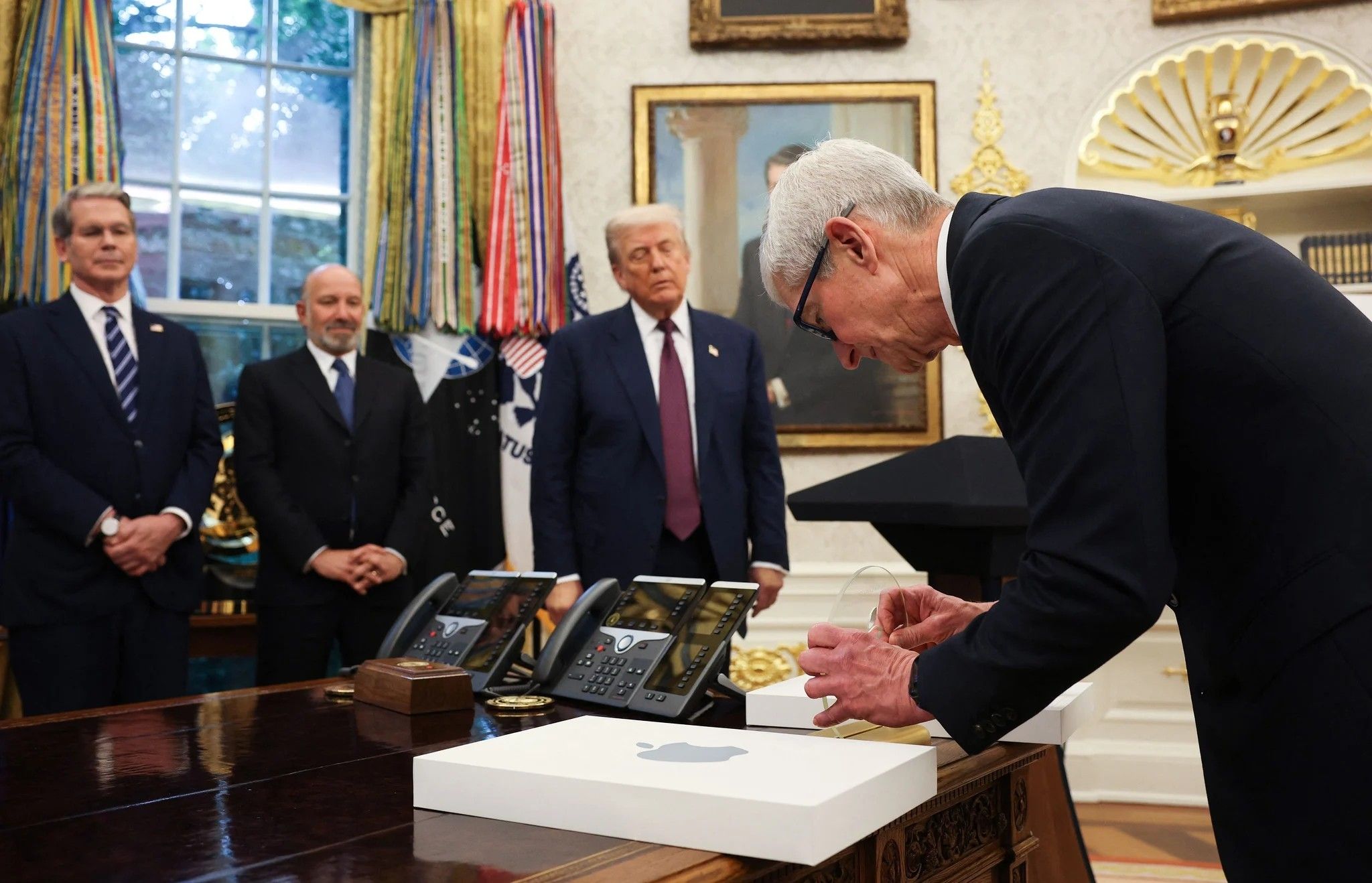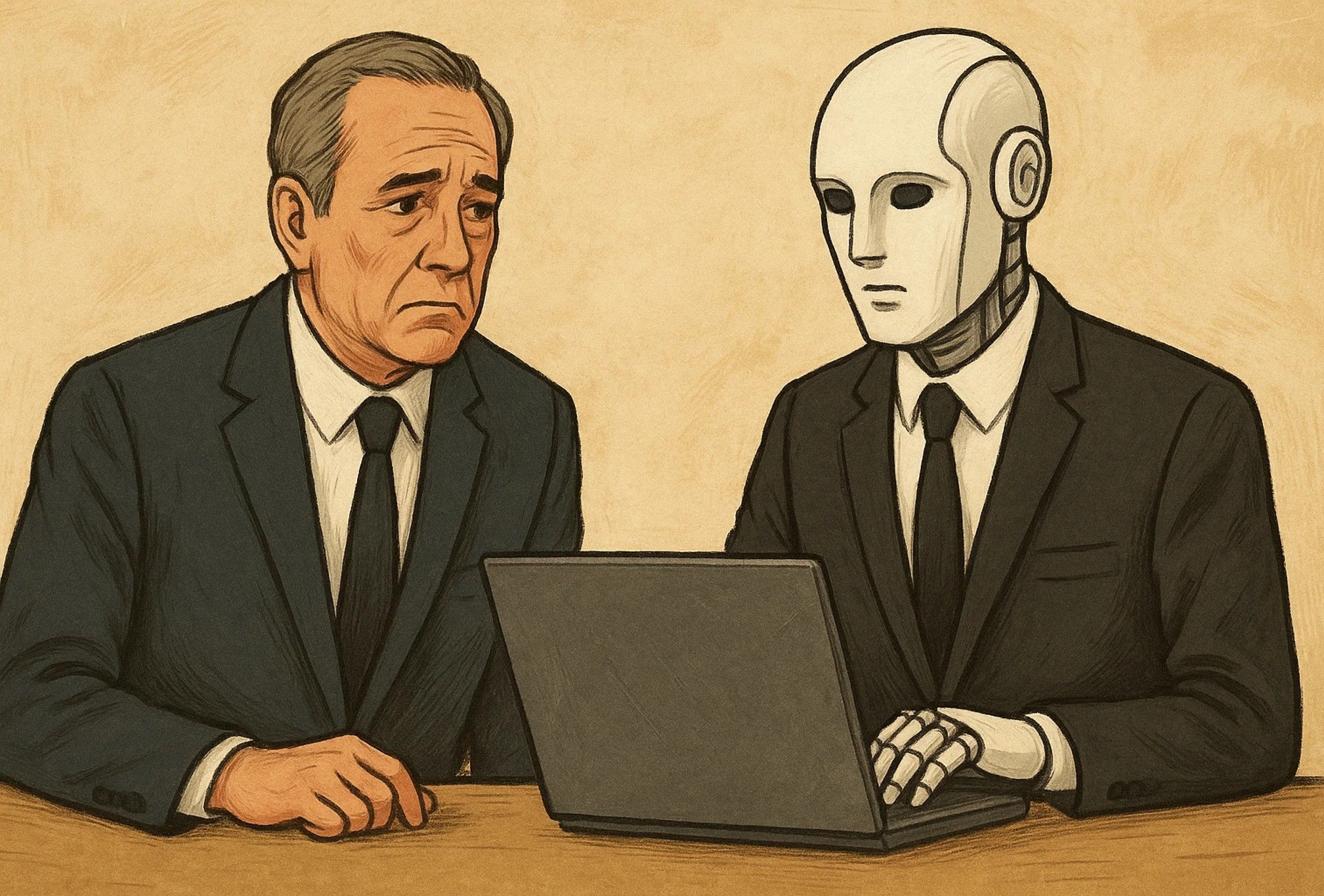Schweiz, aufgepasst!
Kaum ein Land hat sein öffentliches Image so erfolgreich gepflegt wie die Schweiz. Neutralität, Diskretion, Stabilität und, in den Augen vieler, ein Refugium für Steueroptimierer. Die Eidgenossenschaft, das vermeintliche Steuerparadies. Der Mythos des Niedrigsteuerlands hat lange getragen, im Ausland wie im Inland. Doch wie alle weitverbreiteten Meinungen verdient auch diese einen zweiten Blick – empörungsfrei, dafür umso faktenreicher.
Wer die fiskalische Realität der Schweiz in ihrer Gesamtheit betrachtet, erkennt bald: Die oft zitierte Steuerfreundlichkeit ist ein höchst relativer Begriff. Die erweiterte Steuerquote, die neben direkten Steuern auch Sozialabgaben, Pensionskassenbeiträge und Krankenkassenprämien umfasst, liegt heute bei über 40 Prozent.
Mit anderen Worten: Der durchschnittliche Erwerbstätige hat de facto gegen die Hälfte seines Einkommens nicht zur freien Verfügung. Im Hintergrund geschieht eine stille Umleitung – nicht in illegale Kanäle, sondern in das kaum mehr überblickbare Räderwerk der öffentlichen Verwaltung.
Nicht der Markt, sondern der Staat plant
Der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk hat für solche Konstellationen den treffenden Ausdruck geprägt, es handle sich bei ihnen um «Semi-Sozialismus auf eigentumswirtschaftlicher Grundlage». Diese Formel umschreibt die Faktenlage in modernen Fiskalstaaten präzise. Denn Eigentum existiert zwar weiterhin, doch die Bedingungen seines Gebrauchs werden zunehmend durch politische Entscheidungen geprägt. Die Erwerbstätigen entscheiden nur noch über die Hälfte ihres Verdienstes, über die andere Hälfte befinden gewählte Politiker und nicht gewählte Beamte. Nicht der Markt, wie viele wohl denken, sondern der Staat übernimmt die Ressourcenplanung.

Eine stille Entwicklung seit Jahrzehnten! In den letzten 30 Jahren hat sich der jährlich wachsende Bundeshaushalt auf 86,5 Milliarden Schweizer Franken mehr als verdoppelt. Die Ausgaben für soziale Wohlfahrt haben sich im selben Zeitraum sogar verdreifacht. Es ist nicht nur eine fiskalische Expansion, sondern auch eine strukturelle Verschiebung der Kräfteverhältnisse – weg von der Gesellschaft hin zum vermeintlichen Alleskönner Staat.
Der Staat wächst, der Spielraum schrumpft
So erstaunt es kaum, dass die Beschäftigung vor allem in staatsnahen Bereichen gewachsen ist: Gesundheit, Bildung, Sozialwesen. In diesen Sektoren spielen Marktlogiken allenfalls noch am Rande. Geprägt werden sie stattdessen durch staatlich bestimmte Preise, Subventionsregime und Verwaltungslogiken.
Parallel dazu schrumpft der unternehmerische Handlungsspielraum. Kleine und mittlere Betriebe – das Rückgrat der Schweizer Volkswirtschaft – sehen sich einer steigenden Flut von Regulierungen gegenüber, die viel produktive Zeit fressen und das Geschäft behindern.
Die Fehlentwicklung lässt sich auch an der Preisbildung ablesen, sind doch laut Landesindex der Konsumentenpreise rund 25 Prozent aller Preise administriert – doppelt so viele wie im EU-Durchschnitt. Es sind Preise, die nicht im freien Spiel von Angebot und Nachfrage entstehen, sondern aus Verhandlungen zwischen Regulierungsgremien, Verbänden und quasi-monopolistischen Akteuren. Die Schweiz hat sich in eine Bastion eines feinkalibrierten Dirigismus gewandelt – Avantgarde der Marktwirtschaft war einmal.
Bequem, aber riskant
Die Schweiz ist längst zu einem Hybrid geworden, auch wenn die Öffentlichkeit davon noch kaum Kenntnis genommen hat: Sie verbindet marktwirtschaftliche Rhetorik mit einer politischen Praxis, die den Zugriff auf finanzielle Ressourcen intensiviert. Der Bürger, formal Souverän, wird real zum Beitragszahler, zum Finanzierer eines Apparates, der sich seiner Kontrolle entzieht.
Die Eidgenossenschaft stellt seit ihrer Gründung 1848 ein Labor des modernen Staatsdenkens dar: einen Ort, an dem das Verhältnis von Freiheit und Fürsorge, Markt und Moral, Eigentum und Umverteilung immer neu verhandelt wird – meist leise, oft pragmatisch, selten prinzipientreu. Das mag bequem sein. Aber es ist auch riskant. Denn wo der Bürger nur noch Abgabepunkt im System ist, verliert er den Blick für das Ganze – und am Ende auch das Interesse daran. Was bleibt, ist ein Gemeinwesen mit hoch entwickelter Verwaltungslogik, aber schwindender marktwirtschaftlicher Seele.
Im Hintergrund dräut die immer akutere Frage: Wer soll in Zukunft entscheiden, wie wir leben wollen: die Menschen, die sich etwas auf ihre Mündigkeit einbilden – oder das System, das uns von ihrer Mühe zu erlösen vorgibt?
* René Scheu ist Philosoph und Geschäftsführer des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) in Luzern.