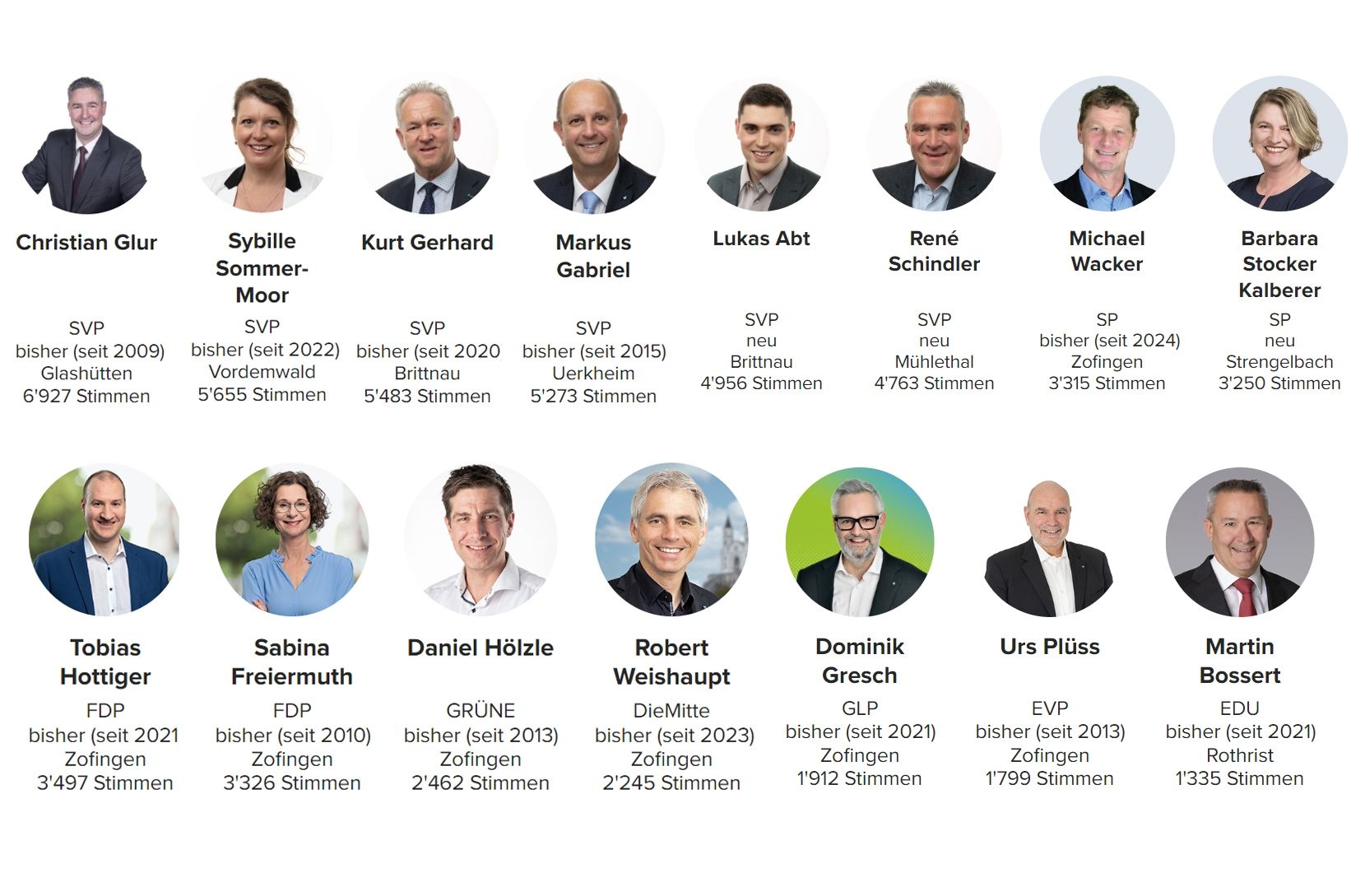«Hätte der KSA-VR tatsächlich keine Strategie, wäre er ein ganz schlechter Verwaltungsrat»
Sabina Freiermuth ist seit 2010 Grossrätin und präsidiert seit 2021 die Freisinnigen im Aargau. Als Mitglied der grossrätlichen Gesundheitskommission beobachtet sie die Debatte um das Spital Zofingen mit besonders grossem Interesse – und mit grosser Sorge, wie sie sagt.
Dass der Verwaltungsrat des Kantonsspitals Aarau (KSA), zu dem Zofingen gehört, erst Ende Jahr dem Regierungsrat mitteilen muss, wie es mit dem Standort Zofingen weitergehen soll, sei «sehr bedauerlich, und schadet dem Spital», so Freiermuth im zt Talk.
«Die Strategie hätte bereits letztes Jahr vorliegen sollen.» Sie fehle nicht, weil in Zofingen Fehler passiert seien. «Sie ist nicht da, weil im KSA in den letzten Jahren sehr viel Unruhe war, mit vielen Wechseln an der Spitze.» Auch hier sei der Regierungsrat in der Pflicht: «Er ist am Schluss in der Verantwortung als Eigentümer.» – «Dass man in Zofingen gewisse Sachen NICHT macht, sind auch Handlungen und Aussagen. Ich fordere die Verantwortlichen auf, die Strategie oder zumindest die gedachten Szenarien jetzt offenzulegen. Hätte der VR tatsächlich keine Strategie, wäre er ein ganz schlechter Verwaltungsrat.» Für das Schweigen müsse es andere Gründe geben. In der gesundheitspolitischen Gesamtplanung hätten sich der Regierungsrat und der Grosse Rat dafür ausgesprochen, dass es weiterhin Regionalspitäler gibt. «Dass gewisse Leistungen nicht mehr angeboten werden – das kann sein. Aber eine Grundversorgung muss in Zofingen bleiben. Wir erwarten, dass wir die Informationen jetzt erhalten.»
Im Talk begründet die FDP-Kantonalparteipräsidentin auch, warum sie den Mittelstand entlasten will. «Der Mittelstand steht am Morgen auf und geht arbeiten – ein Arbeitsleben lang. Diese Leute stemmen unser Land. Sie haben vermehrt das Gefühl, dass sie immer viel arbeiten, aber immer weniger übrigbleibt.» Gleichzeitig öffne der Staat immer mehr Schleusen, um Anspruchshaltungen zu erfüllen. «Das müssen wir stoppen.» Sonst nehme die Bereitschaft ab, sich für das Land einzusetzen. Der Mittelstand dürfe nicht durch neue Steuern belastet werden. Der Aargau budgetiere seit sieben Jahren falsch – «2023 waren 400 Millionen mehr in der Kasse als vorgesehen». Damit müsse Schluss sein: «Wenn man immer zu viel einnimmt, muss man der Bevölkerung auch etwas zurückgeben.» Deshalb werde die FDP in der Budget-Debatte mindestens drei Prozent Reduktion bei der Kantonssteuer fordern.
Über die Diskussion, das Verbot neuer Atomkraftwerke zu kippen, sei sie froh, sagt sie. Die Energiestrategie 2050 operiere mit falschen Zahlen. «Wir brauchen weit mehr Strom, wenn wir alle Bedürfnisse befriedigen wollen – beispielsweise die Elektrifizierung des Verkehrs, wenn wir CO2-neutral werden wollen.» Bis 2050 brauche die Schweiz 90 Terrawattstunden – heute sind es rund 60 Terrawattstunden. Ein Verbot neuer Kernkraftwerke bewirke, dass in diesem Bereich die Forschung nicht mehr vorangetrieben werde. «Deshalb müssen wird das Verbot aufheben – was nicht heisst, dass wir schon übermorgen ein neues AKW bauen.»

«Ich glaube, dass eine inklusive Gesellschaft eine gerechtere Gesellschaft ist»

«Der Wald ist im Grossen Rat zu wenig vertreten»

In den Altstadtgassen von Zofingen entstand ein witziges Musikvideo

Tierische Soldaten in Zofingen: «Pferde rücken ein wie andere Rekruten»

Musikalischer Eigensinn: Wiliberg singt am 1. August seinen eigenen Psalm

Mein erstes Mal: Wenn man aussieht wie an Mumps erkrankt und klingt wie ein sterbender Elefant

Mein erstes Mal als Deutsche in der Schweiz: Leiden auf 1150 Stufen

Mein erstes Mal als Deutsche in der Schweiz: Rüeblitorte backen, Cervelat essen und Rivella trinken

«Eine Maut am Gotthard bringt schlichtweg nichts»
In Zofingen kennt man ihn als Lokalpolitiker – auf dem nationalen Parkett weibelt André Kirchhofer für die Interessen des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbandes Astag, bei dem er als Vizedirektor unter anderem für das Dossier Public Affairs zuständig ist. Der Verkehrsexperte war diese Woche Gast im zt Talk.
«Als ich diese Push-Meldung bekam, wusste ich: ‹Jetzt geht es los›», sagt er über den Erdrutsch zwischen Lostallo und Mesocco, der am 5. Juli einen Teil der A13 zerstörte. «Im Grundsatz kann man sagen: Das Krisenmanagement, das das Bundesamt für Strassen einleitete, war hervorragend. Etwas vom Wichtigsten in einem solchen Fall ist ein international koordiniertes Verkehrsmanagement, damit der Schwerverkehr möglichst gar nicht durch die Schweiz, sondern über Österreich oder Frankreich fährt.»
Was sagt Kirchhofer zur Forderung nach einer Maut am Gotthard, wo es auch unter der Woche zu langen Staus kommt? «Die Meinung des Verbandes, aber auch meine persönliche Meinung ist sehr klar: Nein. Es braucht keine Maut. Es wäre erstens eine Ungleichbehandlung des Tessins; die Gotthard-Strecke ist die einzige Verbindung in den Südkanton, die während des ganzen Jahres problemlos befahren werden kann. Wenn wir hier die Kosten erhöhen, wäre das nicht solidarisch. Zweitens: Verkehr reagiert nicht sehr stark auf Preisänderungen, selbst wenn 20, 30 oder 40 Franken für eine Durchfahrt fällig würden. Der Verkehr wird nicht weniger. Es bringt also schlichtweg nichts, wenn man eine Maut einführen würde.» Die Schweiz habe 1848 entschieden, dass sie von den Binnenzöllen wegkommen wolle. «Verkehr und Mobilität sind Voraussetzungen, dass ein Land prosperieren kann. Wenn man am Gotthard eine Maut einführen würde, muss man sich fragen: Was passiert an Orten, die ebenso stark, wenn nicht stärker belastet sind? Vor dem Gubrist zum Beispiel? Soll man dort auch eine Maut einführen? Wenn wir das in unserem kleinen Land überall machen, dann würde das eine Zusatzbelastung für unsere Wirtschaft, das Gewerbe und die Bevölkerung bedeuten. Deshalb kommt eine Maut für unseren Verband absolut nicht in Frage.»
Als Astag-Vizedirektor weibelt er für den Ausbau der A1, über den im November an der Urne abgestimmt wird. Die Planung des Nationalstrassennetzes stamme aus den 50er- und 60er-Jahren. Seither seien Wirtschaft und Bevölkerung massiv gewachsen – und damit der Bedarf an Mobilität. Das Angebot reiche auf gewissen neuralgischen Strecken nicht mehr. «Es gibt Handlungsbedarf.» Verkehr auf längeren Strecken sollte immer auf dem Nationalstrassennetz fliessen: «So kann man vermeiden, dass er in die Dörfer und Städte ausweicht, wo man ihn nicht haben will, weil beispielsweise die Schulweg-Sicherheit gefährdet ist.»
Gibt es Möglichkeiten, die Staus auf den Autobahnen kurz- bis mittelfristig zu begrenzen? Eine Massnahme, die wirke, sei ein optimiertes Verkehrsmanagement – beispielsweise mit flexiblen Geschwindigkeiten, wie es heute schon praktiziert wird. «Bei 80 km/h hat eine Autobahn nachweislich die höchste Kapazität», so Kirchhofer. Geplant ist, das System mit flexiblen Geschwindigkeiten auf einer Länge von 1700 Kilometern einzuführen. «Eine zweite Massnahme ist die Umnutzung von Pannenstreifen; im Raum Bern hat man damit positive Erfahrungen gemacht.» Das am stärksten wachsende Segment sei im übrigen der Freizeitverkehr; «Mobilität also, die die man nicht zwingend braucht. Aus Verbandssicht muss ich sagen: Kein einziger Transportunternehmer fährt aus Vergnügen in der Gegend herum. Wenn man das Verkehrsproblem lösen wollte, müsste man im Freizeitverkehr ansetzen.»

Bild: Samuel Golay

Hier fliegt ein Klassenzimmer heran – beim Gemeindeschulhaus entsteht ein Provisorium

Willy Loretan im zt Talk: «Ich habe immer nach dem Grundsatz gelebt: Servir et disparaître»
Zum Interviewtermin mit dem ZT lässt sich Willy Loretan vergangenen Dienstag mit dem Taxi chauffieren – seine «Gehwerkzeuge» seien sein Handicap, meint er. Mental ist er – wie sich im Talk zeigen wird – konzis und fit wie eh und je.
Welche Bedeutung hat für ihn die Schwelle des 90. Geburtstages? «Es ist die wichtigere Schwelle als beim 80., und die noch wichtigere als beim 70. Geburtstag», sagt der Jubilar. «Ich bin sehr glücklich, dass ich dieses hohe Alter gesund und munter erreichen kann.» Für seine Gesundheit hat er immer einiges getan: «Ich hielt mich körperlich fit – mit Joggen, Langlauf, Wandern und Hochtouren in Saas Fee.» Jeden Tag liest er drei Zeitungen: das ZT natürlich, die «NZZ», den «Walliser Boten», auch das Wochenblatt «The Economist» hat er abonniert.
Die aktuelle Diskussion um die Aufrüstung der Armee verfolgt er deshalb intensiv. «Adolf Ogi hat mir einmal in seinem Büro unter vier Augen gesagt: ‹Hör mir auf mit der Armee 95 (Organisation der Armee von 1995 bis 2003, die Red.)! Meine Armee ist die Armee XXI (grosses Reformprojekt, die Red.).›» Bestände, Strukturen und Material seien abgebaut, die «Drückebergerei» sei ermöglicht worden. «Deshalb fehlt es nicht nur an Rüstung, sondern auch an Personal.» Das Motto müsse lauten: «Si vis pacem para bellum – wenn Du Frieden willst, bereite den Krieg vor.» In sicherheitspolitischer Hinsicht müsse die Armee punkto Finanzen absolute Priorität haben – ohne Umgehung der Schuldenbremse, fordert Loretan. Sparmöglichkeiten gebe es genug, beispielsweise in der Entwicklungshilfe oder in der üppig wuchernden Bundesbürokratie.
Das Polit-Geschäft habe sich seit seiner aktiven Zeit massiv verändert, stellt er fest. «Zu meiner Zeit gab es weder Handys noch Social Media – man war nicht 24 Stunden am Tag unter Druck und musste jederzeit erreichbar sein. Man musste nicht zu jeder Zeit irgendetwas zu einem Thema sagen, weil es der Journalist gerade wissen will. Die Hektik ist enorm. Das möchte ich nicht erleben.»
Auf seine Nach-Nach-Nachfolgerin Christiane Guyer – Loretan war von 1974 bis 1992 Stadtammann von Zofingen – angesprochen, sagt er: «Eine heikle Frage. Ich habe immer nach dem Grundsatz gelebt: Servir et disparaître – dienen und abtreten. Dass drei ehemalige Bundesräte einen Brief zur AHV-Abstimmung verfasst haben, habe ich gar nicht geschätzt. Das habe ich ihnen auch geschrieben. Über meine Nachfolger – den verstorbenen Urs Locher, Hans-Ruedi Hottiger und Christiane Guyer – mich zu äussern, steht mir nicht zu. Die Problemstellungen heute sind anders, wir haben eine andere Zeit. Es wäre vermessen, wenn ich Qualifikationen abgeben würde. Mir scheint wichtig, dass ein Stadtpräsident oder eine Stadtpräsidentin zentral führt und den ganzen Laden im Griff hat – ohne Verzettelung.»
Ein grosser Staatsdiener
Willy Loretan wurde am 15. Juni 1934 in Basel als Sohn eines Postbeamten geboren. 1941 zügelte seine Familie von Naters VS nach Zofingen, wo er die Schulen besuchte. Nach der Maturität an der Alten Kantonsschule Aarau studierte er von 1955 bis 1961 Recht an den Universitäten Lausanne und Zürich. Später – 1982 – wurde er Ehrenzofinger und damit, obwohl nicht aktiv, Mitglied der Studentenverbindung Zofingia.
1961 doktorierte er und arbeitete danach als Gerichtsschreiber am Bezirksgericht Zofingen. 1964 erhielt Loretan das Rechtsanwaltspatent und wechselte zur aargauischen Kantonsverwaltung, wo er im Baudepartement als juristischer Adjunkt tätig war. Von 1966 bis 1973 präsidierte er das Zofinger Bezirksgericht.
1966 wurde er Mitglied des Zofinger Einwohnerrats, den er 1972 und 1973 präsidierte. Von 1969 bis 1981 gehörte er dem Grossen Rat des Kantons Aargau an, wo er Fraktionspräsident der FDP war. Von 1974 bis 1992 war er Stadtammann von Zofingen. 1979 wurde er in den Nationalrat gewählt, 1991 folgte die Wahl in den Ständerat, dem er zwei Legislaturen angehörte. Loretan war 1982 bis 1992 auch Präsident der Schweizerischen Stiftung für Landschaftsschutz und von 1996 bis 2001 Präsident des Schweizerischen Zivilschutzverbandes.
Er war mit Annemarie Loretan-Wirz verheiratet, die 2014 verstarb. Er ist Vater von zwei Kindern und hat vier Enkelkinder. Er wohnt an der Pfistergasse in der Altstadt von Zofingen.