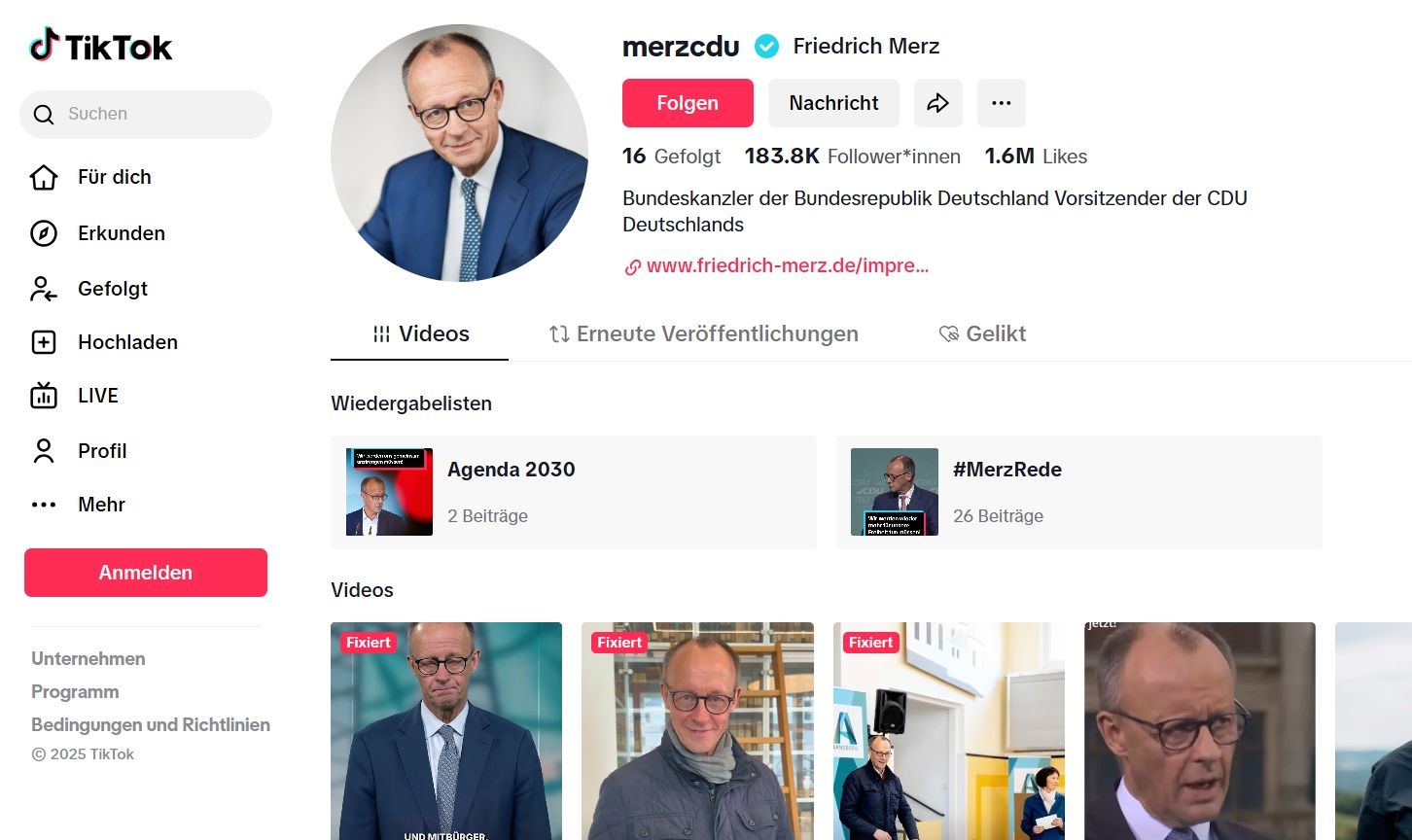Unheilbar krank auf Tiktok: «Ich müsste längst tot sein»
Wenn sich Vanessa mit der Haarbürste über die kahle Stelle an ihrem Hinterkopf fährt, wenn sie weint, über Sinn und Unsinn von ChatGPT-Diagnosen spricht oder darüber nachdenkt, ob es nicht einfacher wäre zu sterben, schauen ihr Zehntausende zu.
Eines ihrer Videos über die Freitodbegleitung durch Exit und Dignitas wurde über eine halbe Million Mal aufgerufen und verzeichnete fast 500 Kommentare. Einer lautet: «Guter Plan. Ich musste mitansehen, wie der Krebs meinen Papa ‹gefressen› hat.» Jemand anders kommentiert: «Ich bin auch bei Exit und es ist für mich sehr befreiend und beruhigend, dass ich selber entscheiden kann, wann und wie ich diese Welt verlasse.»
Vanessa sitzt im Garten der Villa Sträuli in Winterthur, nippt am Schaum ihres Cappuccinos und lässt die warmen Morgensonnenstrahlen auf ihre Arme scheinen. Mit Tiktok will sie andere Krebsbetroffene, insbesondere auch junge Frauen mit Krebs, erreichen. «Gleichzeitig ist Tiktok ein Tagebuch für mich, für meine Psychohygiene.»
Diagnose: Triple-negativer Brustkrebs
Die 37-Jährige lacht viel, nur manchmal drückt sie eine Träne weg. Etwa, wenn sie von den Metastasen erzählt, die in den vergangenen zweieinhalb Jahren trotz Chemotherapie, Bestrahlung und Operationen immer wieder aufgetaucht sind. Oder von dem Tag, als sie ihre langen Haare abrasieren musste. Wie sie sich deshalb vor ihrem Freund schämte. «Es sind nicht einfach nur Haare», sagt sie. «Es war ein Identitätsverlust.» Und dann war da noch die Thailand-Reise, zu der sie aufbrach, obwohl ein Tumor in ihrem Kleinhirn wuchs. Denn sie wusste: «Es könnte meine letzte Reise sein.»
Im Februar 2023 erhielt Vanessa die Diagnose triple-negativer Brustkrebs, eine besonders aggressive, schnell wachsende Form, die vor allem Frauen unter 40 betrifft. Solange der Tumor lokal bleibt, liegen die Überlebenschancen bei über 90 Prozent. Doch bei Vanessa hatte der Krebs schon gestreut, sich ins Gehirn, in die Kopfhaut, die Lymphknoten, die Lunge gefressen. «Eigentlich müsste ich längst tot sein», sagt sie.

Bild: Stephanie Schnydrig
Durch die Maschen gefallen
Eine Krebsdiagnose kann überwältigen. Früher mussten Betroffene und ihre Angehörigen damit allein klarkommen. Denn Krankheit war eine «private Erfahrung», wie es der Soziologe Peter Conrad formulierte. Doch mit dem Internet habe sie sich zunehmend zu einer öffentlichen Erfahrung gewandelt. Mit der Digitalisierung seien Tausende von Online-Gemeinschaften entstanden, in denen Betroffene ihre Krankheitsgeschichte festhalten, Erfahrungen austauschen und sich unterstützen.
Eva De Clercq forscht am Institut für Bio- und Medizinethik der Universität Basel. Ihr zufolge fallen gerade junge Krebspatientinnen und -patienten oft durch die Maschen. Sie sind zu alt für die Kinderonkologie, zu jung für die Altersmedizin. Doch vielleicht, so die Hoffnung, können soziale Medien diese Lücke schliessen. «Der Einsatz sozialer Medien kann verschiedene Aspekte der Versorgung verbessern – von der Bereitstellung von Informationen über die Therapietreue bis hin zur psychosozialen Unterstützung», sagt De Clercq.
In einem Forschungsprojekt hat sie untersucht, wie Jugendliche und junge Erwachsene mit Krebs soziale Medien nutzen. Viele suchten zu Beginn ihrer Erkrankung gezielt nach Informationen, gaben aber bald wieder auf – «weil sie sich durch widersprüchliche oder unverständliche Inhalte eher verunsichert fühlten», so De Clercq. Zudem seien viele Accounts englischer Sprache und nicht in der Muttersprache der Betroffenen.
Umso wichtiger sei es, dass Gesundheitsfachpersonen auf Tiktok, Instagram und Co. präsent seien. Doch bislang sei das selten der Fall. Zum einen, weil viele Fachpersonen zögerten – aus Sorge, berufliche Grenzen zu überschreiten. Zum anderen, weil sie oft gar nicht wüssten, dass ihre Patientinnen und Patienten in den sozialen Medien nach Informationen suchten. «Diese Unkenntnis führt dazu, dass die Chance verpasst wird, Information, Aufklärung und Betreuung genau dort anzubieten, wo sie gebraucht wird.»
Die Basler Forscherin ist überzeugt, dass die Medizin einen Weg finden muss, die sozialen Medien konstruktiv zu nutzen, da man auf sie nicht verzichten kann. «Ganz einfach, weil sie Teil der Lebenswelt der jungen Menschen sind.»
Eingesperrt in einem dunklen, kalten Raum
Nach der Diagnose fühlte sich Vanessa wie eingesperrt in einem kalten, dunklen Raum, orientierungslos, so schildert sie es. Sie wollte nicht allein bleiben in dieser neuen, beängstigenden Welt und suchte deshalb Menschen, die Ähnliches durchmachen. «Denn so sehr Familie und Freunde da sind: Es ist nicht dasselbe.» So ging sie zu Tiktok, zunächst mit einem anonymen Account, mit dem sie lediglich beobachtete, was es dort so gab. Doch sie fand wenig, was ihr half. Und: «Die Chemo hat alles von mir abverlangt. Ich hatte keine Energie für irgendetwas anderes.»
Später kehrte sie zurück – diesmal nicht mehr anonym. In ihren Videos trat sie offen auf: als krebskranke Frau, gezeichnet von den Spuren der ganzen Therapien. Ihren Account nannte sie «InfluCancer» und begann, über Themen zu sprechen, über die sie selbst gerne frühzeitig mehr erfahren hätte.
Etwa zur Fruchtbarkeit. Vor der ersten Chemotherapie spritzte sie sich Hormone, um das Wachstum der Eizellen anzuregen, die später für eine Kryokonservierung entnommen wurden. Die Kosten für die Hormonspritzen übernahm ihre Krankenkasse zunächst nicht. Erst nach zahlreichen Telefonaten, Rückfragen und einem ausführlichen Schreiben ihrer Ärztin wurde das Gesuch bewilligt. «Mit Unterstützung der Krebsliga habe ich mir das mitten in der Chemotherapie erkämpft», sagt Vanessa.
Auch über Nebenwirkungen spricht sie. Aber nicht so, wie man sie im Beipackzettel nachlesen kann. Sondern so, wie sie sich anfühlen. Etwa die Scheidentrockenheit oder die künstlichen Wechseljahre, in die viele Krebspatientinnen mit Medikamenten wie Zoladex versetzt werden. «Plötzlich schwitzt du ständig, nimmst zu, dein Körper verändert sich.» Auch darüber redete sie auf Tiktok und merkte, dass viele Frauen das Gleiche erleben.
Wieso Nichtbetroffene hingucken
Krankheit und Tod sind in westlichen Gesellschaften nach wie vor tabuisiert. Soziale Medien machen es möglich, das Tabu zu brechen. Erkrankte sprechen öffentlich über ihre Diagnose, über ihren Alltag mit Schmerzen, Therapien, Angst und über das Sterben. Wer will, kann alles mitverfolgen – in Echtzeit. Warum Menschen, die selbst gesund sind, diesen Accounts folgen, erklären verschiedene psychologische Konzepte. Es geht um Neugier, mitfühlende Fürsorge, voyeuristische Faszination oder um das Bedürfnis nach Information und Selbstvergewisserung. Eine Rolle spielt auch die sogenannte morbide Neugier. Der Verhaltenspsychologe Coltan Scrivner von der Universität Aarhus in Dänemark hat während der Corona-Pandemie untersucht, weshalb manche Menschen ein besonders starkes Interesse an bedrohlichen Informationen rund um das Virus zeigten. Seine Schlussfolgerung: Wer eine hohe morbide Neugier hat, sucht gezielt nach erschreckenden Details – nicht aus Panik, sondern aus echtem Interesse. Dasselbe psychologische Motiv lässt Menschen gern Horrorfilme schauen. (sny)
Mobbing selbst gegen Krebserkrankte
So gut alles klingen mag: Die sozialen Medien bergen auch Risiken. De Clercq und ihr Team haben sie in einer Studie systematisch erfasst. Ein zentraler Punkt: die Verbreitung von unzuverlässigen oder pseudowissenschaftlichen Inhalten über Krebs. Diese Gefahr wurde jüngst durch die Netflix-Serie «Apple Cider Vinegar» aufgegriffen. In der Geschichte, die zum Teil auf wahren Begebenheiten beruht, behauptet eine Influencerin, durch gesunde Ernährung sowie alternative Medizin von Krebs geheilt worden zu sein.
Vanessa weiss, wie schnell sich solche falschen Hoffnungen verbreiten und wie gefährlich das sein kann. «Täglich sehe ich Accounts, die behaupten: Mit Pilzen, Pulvern, Diäten wirst du gesund. Kein Zucker, keine Milch, kein Fleisch – zack, geheilt. Das ist fahrlässig.» Sie selbst mache keine Versprechen, sondern wolle Leute ermutigen, sich zu informieren, kritisch zu bleiben und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. «Denn der Körper sendet Signale. Wir müssen nur lernen, sie ernst zu nehmen.»
Gemäss der Studie von Eva De Clercq berichten manche Betroffene, dass die Inhalte auf den sozialen Medien sie emotional überforderten. Zum Beispiel, wenn sie vom Tod anderer Betroffener erfahren. Wer persönliche Erfahrungen in sozialen Medien öffentlich macht, kann zudem unbeabsichtigt seine Privatsphäre gefährden und unter Umständen mit negativen Reaktionen bis hin zu Cybermobbing konfrontiert werden.
Auch Vanessa blieb von Anfeindungen nicht verschont. In einem Video isst sie ein Nutella-Glacé – kurz darauf tauchen Kommentare auf wie: «Kein Wunder, dass du Krebs hast.» Unter anderen Videos heisst es: «Wenn du dich beim Weinen noch filmen kannst, geht’s dir wohl nicht so schlecht.» Oder: «Selber schuld – dein Krebs ist ein Corona-Impfschaden.» Vanessa sagt: «Wenn es unter die Gürtellinie geht, sperre ich die Person.» Denn für sie gilt das ungeschriebene Gesetz: Man tritt nicht auf jemanden, der schon am Boden liegt.
Doch nochmals eine Chemo
Allerdings betont Vanessa, dass die Mehrheit der Reaktionen positiv sei. Auch deshalb investiert sie viel Zeit ins Planen, Filmen und Schneiden ihrer Videos. Das nächste hat sie schon im Kopf: Es wird eine gute Nachricht enthalten, indem sie vor Freude weinen wird. Weil sie ihren Geburtstag im September entgegen ihrer Vermutung wohl wird erleben dürfen.
Denn erst heute Morgen hat sie die Ergebnisse des jüngsten sogenannten Stagings erhalten: Das ist eine umfassende Untersuchung, die zeigt, ob der Krebs weitergewachsen ist, gestoppt werden konnte oder sich zurückgebildet hat. «Ich konnte es kaum glauben», erzählt Vanessa. Denn die Lungenmetastasen sind verschwunden, die Hirnmetastasen kleiner geworden, der Tumor in der Brust hat sich halbiert. «So muss sich ein Lottogewinn anfühlen.»
Grund für den Rückgang der Krebsgeschwüre ist eine neue Therapie: Enhertu. Eigentlich wollte Vanessa keine weitere Chemotherapie mehr. «Ein drittes Mal schaffe ich es nicht», dachte sie. Für sie war klar: Ich höre auf. Aber durch den Austausch auf Social Media, die Gespräche mit anderen Betroffenen, setzte sie sich nochmals mit ihrem Gefühl auseinander – und merkte: «Doch, ich will es noch einmal versuchen.»
Heute erhält Vanessa alle drei Wochen eine Infusion mit dem Antikörperwirkstoff Trastuzumab-Deruxtecan – ein Leben lang. «Was auch immer ‹ein Leben lang› in meiner Situation bedeutet», sagt sie. In Zulassungsstudien verlängerte das Medikament das Leben im Schnitt um ein halbes Jahr: von 17,5 auf 23,9 Monate. Was solche Zahlen in Vanessa auslösen? «Prognosen beruhen auf Statistiken», sagt sie. «Und Statistiken auf der Vergangenheit. Aber ich fühle die Zukunft – und lebe im Hier und Jetzt.»