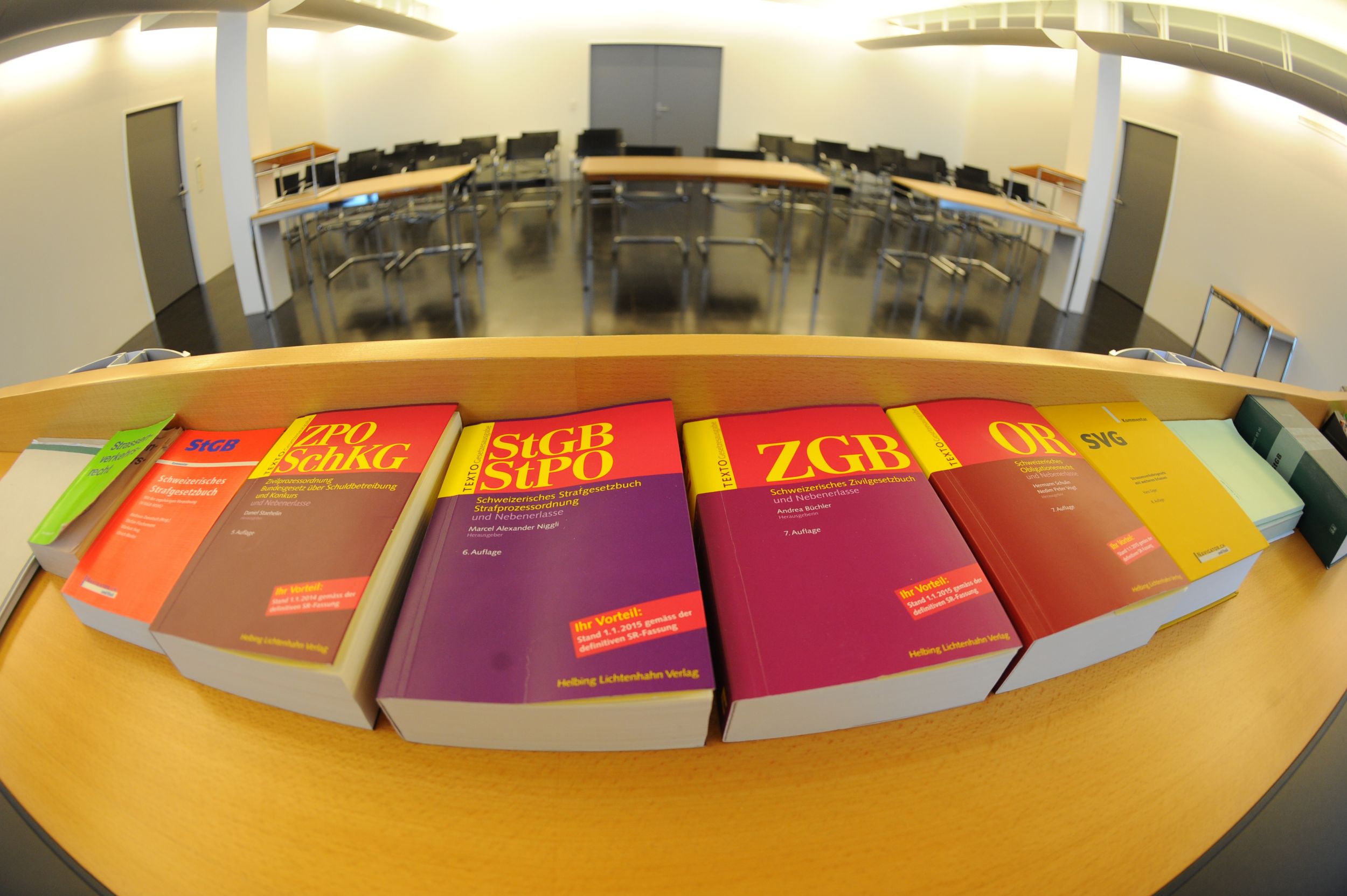«Es ist wichtig, Konflikte möglichst früh beizulegen»: David Bolliger kandidiert als Friedensrichter

Diese Ziele setzt sich der Zofinger Stadtrat für das kommende Jahr
Der Stadtrat will transparenter kommunizieren und die Bevölkerung stärker einbinden. Das neue Legislaturprogramm 2027–2030 soll bis Ende 2026 erarbeitet und veröffentlicht werden. Zudem sollen die Social-Media-Kanäle der Stadt intensiver genutzt werden.
Zofingen möchte sich an einer kantonalen Sprachstanderhebung beteiligen und daraus Massnahmen ableiten. Mit verstärkter Polizeipräsenz und Hotspot-Bewirtschaftung soll das Sicherheitsgefühl verbessert werden. Zudem setzt sich Zofingen als Miteigentümerin der Spitex Region Zofingen AG für eine Senkung der Restkosten um zehn Prozent ein.
Im Verkehrsbereich stehen mehrere Planungsprojekte an: Die Teilrevision des Gesamtplans Verkehr und das neue Betriebs- und Gestaltungskonzept für Frikart- und Brittnauerstrasse sollen abgeschlossen werden. Die Mitwirkung zum neuen Parkierungsreglement soll ebenfalls abgeschlossen werden.
Stadtentwicklung soll vorangetrieben werden
Der Stadtrat will die Aufenthaltsqualität in Zofingen erhöhen, etwa durch die Aufwertung von Grünflächen und die Verbesserung des öffentlichen Raums rund um das Gemeindeschulhaus. Die Altstadtentwicklung wird vorangetrieben. Die Daten aus den Frequenzmessungen in der Altstadt sollen ausgewertet und erste Massnahmen daraus abgeleitet werden. Wichtige Entwicklungsprojekte sind das Swissprinters-Areal, das Funken-Areal sowie die Teilrevision des Bauzonenplans und der Bau- und Nutzungsordnung.
Auch der Klimaschutz und die Energieeffizienz sind unter den Zielen zu finden. Die zweite Etappe der Fernwärme-Erschliessung der Altstadt ist in Planung, und das Hochwasserschutzprojekt Stadtbach wird umgesetzt. Die Fusion der StWZ und der sbo soll vorangetrieben werden. Der Bahnhofplatz wird begrünt und Massnahmen zur Reduktion der Lichtverschmutzung sind vorgesehen. Mit einer neuen Neophytenstrategie und der Aufwertung des Bärenmoosweihers soll die Biodiversität gefördert werden.
Das kulturelle Erbe soll besser gepflegt werden. Das Stadtarchiv wird modernisiert, die Kunstsammlung neu konzipiert und das Gebührenreglement des Stadtsaals überarbeitet. Zudem will sich Zofingen an regionalen Tourismusprojekten wie der Herzroute beteiligen.
Bildungsstandort stärken
Die Bildungsplanung soll weiterentwickelt und Zofingen als Bildungsstandort gestärkt werden. Der Einwohnerrat wird über den Projektierungskredit für die Musikschule entscheiden, und die Schulraumplanung wird konkretisiert. Der Bau des Oberstufenzentrums soll termin- und kostengerecht weitergeführt werden. Die Projektierung der Sanierungs- und Umbauarbeiten für die Tagesstrukturen im Hauptgebäude der Friedau soll abgeschlossen werden.
Die Digitalisierung soll auch vorangetrieben werden. Der Stadtrat möchte neue Softwarelösungen in Verwaltung und Schulen einführen, Prozesse automatisieren und Cloud-Dienste ausbauen. Ein revidiertes Personalreglement ist in Arbeit, und der Stadtrat plant eine langfristige Finanzstrategie.
Die Rolle Zofingens als regionales Zentrum soll gestärkt werden. Dazu gehören die Integration von Uerkheim ins Regionale Zivilstandsamt, die Eingliederung einer weiteren kommunalen Bauverwaltung sowie die Modernisierung der regionalen Sicherheitsorganisationen.

Mehr Schulsozialarbeit, mehr Service – Rothrist reagiert auf steigende Ansprüche
Über fünf Geschäfte (inklusive Verschiedenes und Umfrage) können die Stimmberechtigten an der Wintergmeind entscheiden. Neben der Genehmigung des letzten Protokolls und dem Budget befasst sich die Gmeind auch mit zwei Stellenplanerhöhungen, die auf wachsende Anforderungen und steigende Fallzahlen zurückzuführen sind.
Mehr Arbeit in der Steuerabteilung
Der Gemeinderat beantragt, den Stellenplan der Abteilung Steuern von 520 auf 570 Prozent zu erhöhen. Seit 2016 sei die Zahl der Steuerpflichtigen in Rothrist um rund neun Prozent gestiegen, heisst es in der Erläuterung. Damit betreue eine Vollzeitstelle heute etwa 1115 Fälle. Hinzu kämen komplexere gesetzliche Vorgaben, häufigere Nachfragen und ein grösserer administrativer Aufwand infolge der Bautätigkeit.
Eine Aufstockung sei nötig, um die kantonalen Vorgaben beim Veranlagungsstand einzuhalten und die Qualität der Dienstleistungen sicherzustellen. Letztlich gehe es auch darum, die Steuereinnahmen langfristig zu sichern.
Schulsozialarbeit am Limit
Noch deutlicher macht sich der Druck in der Schulsozialarbeit bemerkbar. Der Gemeinderat will das Pensum von derzeit 210 auf 250 Prozent (ohne Leitung) erhöhen. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler ist seit 2017 von 1180 auf rund 1420 gestiegen – die Fallzahlen in der Schulsozialarbeit von 170 auf 330.
Wegen der hohen Belastung könne die Niederschwelligkeit des Angebots kaum mehr gewährleistet werden, schreibt der Gemeinderat. Prävention und Beziehungsarbeit kämen zu kurz, Wartezeiten nähmen zu. Mit der Aufstockung soll die Situation stabilisiert und die Präventionsarbeit wieder gestärkt werden.
Empfohlen wird ein Arbeitspensum von 50 bis 60 Prozent pro 300 bis 350 Kinder – gemessen daran liege Rothrist derzeit unter dem empfohlenen Wert.
Zukünftig ist zudem eine Zusammenarbeit mit Vordemwald geplant: Ab dem Schuljahr 2027/28 möchte die Nachbargemeinde die Schulsozialarbeit an der Primarstufe einführen und diese Dienstleistung in Rothrist einkaufen. Die zusätzlichen Stellen würden dann kostendeckend weiterverrechnet.
Neben diesen Geschäften wird das Budget 2026 behandelt. Es sieht eine Steuerfusserhöhung von 110 auf 115 Prozent vor, über die an der Versammlung abgestimmt wird (das ZT berichtete). Am Donnerstag, 20. November, um 19 Uhr findet im Gemeindesaal Breiten diesbezüglich eine Informationsveranstaltung statt.

«Jeder hat seine Geschichte und das ist auch gut so» – Ursula Hinden möchte Friedensrichterin werden

Das neue Forstfahrzeug ist dank besserer Auslastung günstiger im Betrieb
Wenn es darum geht, gefällte Bäume im Wald zu bewegen oder aus dem Wald zu transportieren, braucht es einen Forstspezialschlepper. Das Fahrzeug, das der Forstbetrieb Uerkental nutzt, stammt aus dem Jahr 2008 und hätte eigentlich schon im letzten Jahr ersetzt werden sollen. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen wird er erst 2027 ersetzt – dann ist der Ersatz aber zwingend, weil unter anderem die Reparaturanfälligkeit immer grösser wird. Der Forstbetrieb brauche auch weiterhin eine eigene Maschine, steht in den Unterlagen zu den Gemeindeversammlungen von Bottenwil und Uerkheim. So könne beispielsweise bei Unwettern schnell reagiert und umgestürzte Bäume von Wegen und Gewässern weggeräumt werden.
Der Kanton Aargau, Bottenwil und Uerkheim beteiligen sich am Kauf
Die neue Maschine wird besser ausgelastet als die alte und deshalb rund 20 Prozent geringere Kosten pro Maschinenstunde verursachen. Die Maschinenkosten seien aber nicht der einzige entscheidende Faktor bei der Auswahl gewesen, steht in den Versammlungsunterlagen. Es sei auch darauf geachtet worden, dass bestandes- und bodenschonend gearbeitet werden könne. Da die neue Maschine eine 6-Rad-Kombimaschine ist, wird das Gewicht auf sechs Räder verteilt und so der Bodenschutz besser gewährleistet.
Für den Kauf des neuen Fahrzeugs wird ein Kredit von 595´000 Franken nötig. An diesem beteiligen sich laut Verteilschlüssel der Kanton Aargau mit 52 Prozent (309´400 Franken) und Uerkheim und Bottenwil mit je 24 Prozent (142´800 Franken). Die Waldeigentümer rechnen mit einem Verkaufserlös von 80’000 Franken für den alten Forstspezialschlepper. Dieser Betrag wird aber nicht in den Kredit eingerechnet. Er verbessert das Ergebnis des Forstbetriebs, was dann wiederum unter den Eigentümern aufgeteilt wird.
Aktuell verfügt der Forstbetrieb Uerkental über ein Vermögen von 567’420 Franken, das anteilmässig den Waldeigentümern gehört. Zusammen mit dem budgetierten Gewinn aus dem Jahr 2025 von 91’900 Franken verfügt der Forstbetrieb über 659’320 Franken, die zur Finanzierung des neuen Fahrzeuges verwendet werden. So muss zwischen den Waldeigentümern kein Geld fliessen. Was übrigbleibt, wird nach dem Kauf der Maschine den Waldeigentümern ausbezahlt.
Bottenwil als rechnungsführende Gemeinde muss an der Gemeindeversammlung den gesamten Kredit von 567’420 Franken beantragen, Uerkheim hingegen nur den Gemeindeanteil von 142’800 Franken.

Sieben Ziele für eine lebenswerte Gemeinde – so will sich Strengelbach für die Zukunft rüsten
Die strategischen Ziele wurden in zwei Workshops erarbeitet. Sie bildeten die Grundlage für eine nachhaltige, lebendige und zukunftsorientierte Gemeindeentwicklung, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.
So möchte der Gemeinderat etwa die Stärkung des kommunalen Gewerbes vorantreiben. Das lokale Gewerbe soll als zentraler Partner in die politischen Entwicklungen eingebunden werden, um «gemeinsam eine stabile und prosperierende Gemeinde zu gestalten».
Die Bevölkerung soll aktiv mitgestalten
Der politische Diskurs und die Partizipation sollen gefördert werden. Ein aktiv initiierter politischer Diskurs soll die Meinungsvielfalt sichern und die Bevölkerung zur Mitgestaltung motivieren, so der Gemeinderat. Das sichere die Meinungsvielfalt.
Die Mehrfamilienhaus-Quartiere in Strengelbach plant der Gemeinderat weiterzuentwickeln und aufzuwerten. «Aspekte wie Immobilienentwicklung, Freiraumgestaltung und Quartierimage werden gezielt gestärkt, um attraktive Wohnräume zu schaffen», heisst es in der Mitteilung weiter. Geplant ist auch ein Austausch mit Gemeinden, die eine ähnliche Bevölkerungsstruktur haben. Beispielsweise Suhr.
Mit der Bildung hat sich der Gemeinderat ebenfalls auseinandergesetzt. Der Bildungs- und damit auch der spätere Berufszugang soll für alle Kinder optimal sichergestellt werden. Dazu müssen sprachliche Hürden überwunden und mehrsprachige Angebote zur Verfügung gestellt werden. Der Zugang zu den entsprechenden Infos für Kinder und Familien und zur Frühförderung soll sichergestellt werden.
Vereinsleben und Begegnungsorte stärken
Der Sozialraum in der Gemeinde möchte der Gemeinderat ausbauen. «Dazu gehört sowohl die Stärkung von Vereinen als auch ein öffentlicher Raum, welcher Begegnung und Aktivitäten ermöglicht», heisst es vom Gemeinderat. Dazu könnten auch kurzfristige Massnahmen in Betracht gezogen werden. Etwa eine Arbeitsgruppe, in der Teile der Bevölkerung (Jugendliche, Senioren usw.) mitwirken.
Was die Kommunikation mit der Bevölkerung angeht, nimmt sich der Gemeinderat vor, aktiv zu kommunizieren. Das schaffe Orientierung und Vertrauen für alle. Konkret genannt ist etwa ein Quartierstammtisch mit dem Gemeinderat und der Aufbau von mehrsprachigen Kanälen für Verwaltungsinfos. Auch in einfacher Sprache sollen diese aufbereitet werden.
Schliesslich soll auch die interkommunale Zusammenarbeit ausgebaut und proaktiv gepflegt werden. «Das schafft einen Mehrwert in der zunehmenden Komplexität der kommunalen und regionalen Aufgaben.» Als Umsetzungsansatz nennt der Gemeinderat etwa regelmässige Treffen unter den Verwaltungsmitarbeitenden mit den umliegenden Gemeinden.
Fokus auf zwei Ziele in der ersten Phase
Zu Beginn möchte sich die Gemeinde primär auf zwei Ziele fokussieren: Die Förderung des politischen Diskurses und der Partizipation sowie die vertrauensbildende Kommunikation der Gemeinde. «Diese Fokussierung erlaubt eine vertiefte Bearbeitung und schafft die Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung der weiteren Ziele in den kommenden Jahren.»
Erarbeitet wurden die Ziele vom amtierenden Gemeinderat und der Geschäftsleitung. «Die Knochenarbeit liegt nicht nur beim Definieren der Ziele, sondern vielmehr in der Umsetzung», sagt Gemeindeammann Stephan Wullschleger.
Um die Sichtweise der Bevölkerung einzubeziehen, ruft die Gemeinde nun dazu auf, eine eigene Gewichtung der sieben Ziele vorzunehmen und dem Gemeinderat eine Rückmeldung zu geben. «Sei es in Form von Ergänzungen, positiven Anmerkungen oder Hinweisen auf fehlende Aspekte.»
«Für uns ist es spannend, wie die Bürgerinnen und Bürger unsere Ziele sehen und was sie dazu sagen. Hier können wir feststellen, ob die Bevölkerung die Umsetzung gleich priorisiert, wie der Gemeinderat und wo wir die Umsetzung den Wünschen entsprechend anpassen können», so Wullschleger.
Die erarbeiteten Ziele werden anschliessend zusammen mit den Rückmeldungen der Bevölkerung dem neugewählten Gemeinderat übergeben. Dieser wird dann das weitere Vorgehen beschliessen. Aus Erfahrung sei es für neue Mitglieder, die bislang nicht den ganzen politischen Prozess und die Abläufe kennen, einfacher, wenn sie sich an Zielen orientieren können. «Bei der Erarbeitung waren rund neun Personen beteiligt, davon werden zwei ausgetauscht. Ich gehe nicht davon aus, dass der neue Gemeinderat im nächsten Jahr das Rad neu erfinden wird», zeigt sich Wullschleger optimistisch.

Arbeitsloser log über Zwischenverdienst – Gericht spricht ihn des mehrfachen Betrugs schuldig
«Ich gebe zu, dass ich gelogen habe», sagt Hassan (Name geändert) zum Richter. Die Beweislage ist eindeutig: Neunmal gab er auf den monatlich eingereichten Formularen der Arbeitslosenversicherung an, dass er nicht gearbeitet habe, obwohl er als Lagermitarbeiter Lohn erhielt.
Von April 2020 bis Juni 2020 und von Februar 2021 bis Juli 2021 setzte der 38-Jährige das Kreuz jeweils bei Nein. «Ihnen war also bekannt, was Ja und was Nein bedeutet?», fragt Gerichtspräsident Florian Lüthy. «Für mich persönlich ist der Umgang mit Daten sehr schwierig», antwortet der gelernte Fahrzeugwart. Er habe rund 50`000 Franken Schulden, erzählt er dem Richter.
Hassan verlor die Arbeitsstelle nach massivem Mobbing
Hassans Verteidiger legt eine konkursamtliche Bestätigung vor, wonach eine frühere Arbeitgeberin seinem Klienten nach dem Konkurs der Firma noch über 40`000 Franken schuldet. Mitte 2019 verlor Hassan eine weitere Arbeitsstelle, nachdem es dort zu massivem Mobbing gekommen sei, unterstreicht der Anwalt. Danach war Hassan von November 2019 bis Oktober 2021 bei der Arbeitslosenkasse des Kantons Aargau gemeldet und bezog Arbeitslosenentschädigung.
Wegen der falschen Zwischenverdienstangaben des Beschuldigten ging die Arbeitslosenkasse irrtümlich davon aus, dass Hassan stets ohne Einkommen war. «Die Kasse überwies Ihnen gesamthaft 20`627 Franken und 15 Rappen, auf die Sie keinen Anspruch hatten», hält der Richter fest. «Ich war komplett überfordert», erläutert der Familienvater. «Ich wollte mit den falschen Angaben meine Familie retten!» Er bereue den Fehler, bekräftigt er. Heute arbeitet Hassan als Versicherungsvertreter. «Ich will meinen Kindern ein Vorbild sein und zeigen, dass ich mir Mühe gebe und meine Schulden mit der Zeit begleiche.»
Eine Notlage ist kein Grund, etwas zu mauscheln
Hassan wird zu 150 Tagessätzen à 80 Franken total 12`000 Franken, bedingt auf 2 Jahre verurteilt. Zudem muss er eine Busse von 1000 Franken unbedingt bezahlen. «Die Sozialhilfe und die Arbeitslosenkasse helfen Menschen in Notlagen», stellt Gerichtspräsident Florian Lüthy klar, «aber eine Notlage ist kein Grund, um etwas hinten herum zu mauscheln.»

Sven Ivanic kommt mit frecher Schnauze und warmem Herzen nach Zofingen
«An der Uni haben wir die strafrechtlich relevanten Artikel wegen Beleidigung durchgepaukt – aber verklagt wurde ich noch nie», witzelt der Comedian und ausgebildete Jurist Sven Ivanic am Telefon. Beleidigungen seien eben nicht sein Stil. Der Witz muss immer grösser sein als der Schmerz der Betroffenen, lautet seine mathematische Regel.
Dass der grosse Schlaks mit Balkanhintergrund gerne überraschende, nur zum Schein naive Fragen stellt, ist inzwischen einem breiten Fernsehpublikum bekannt. Seine Doku-Formate auf SRF zeigen: Ivanic ist kein Selbstdarsteller, sondern jemand, der sich auch gerne von seinem Gegenüber überraschen lässt. Auch auf der Kleinen Bühne will er Pingpong spielen. «Ich mag es, wenn das Publikum mir Bälle zuwirft – ich jongliere mit ihnen, werfe sie zurück und treffe mit einer Pointe – oder auch nicht», sagt er. Ihn interessiert vor allem die Interaktion – das letzte Wort muss er dabei nicht haben. «Hauptsache, die Leute können herzhaft lachen. Wenn jemand anders den Gag für sich bucht, steht’s eben 1:0 fürs Publikum – da freue ich mich immer mit.»
Das Leben ist zu kurz, um es ernst zu nehmen
Ivanic weiss, dass Spontaneität seine Stärke ist: Innerhalb seines klar aufgebauten Programms agiert er so unbekümmert wie kaum ein anderer. «Das Leben ist einfach zu kurz, um es allzu ernst zu nehmen», erklärt er sein Rezept. Sein Programm bildet den Rahmen, aus dem er jeden Abend, frisch beschossen vom Publikum, neue Pointen hervorzaubert. Trotz aller Schlagfertigkeit hat es selbst ihm einmal kurz die Sprache verschlagen. Hatte doch tatsächlich ein Zuschauer auf die Frage nach seinem Hobby mit harmloser Freundlichkeit entgegnet: «Ich bin ein Kannibale und esse gerne Menschen.»
Heisst das aktuelle Programm «Stilbruch», weil er darin die Figur des «JUSländers» ad acta legt? «Jein», meint Ivanic. Er mache einfach zusätzlich Musik. Die Gegensätze Stadt-Land, Balkan-Schweiz und Jus-Comedy trage er eh in sich. «Doch will ich die Leute noch mit anderen Facetten zum Lachen bringen.» Er spüre genau, wer inklusive der hinteren Plätze, empfänglich sei für einen Schlagabtausch. Diese Leute mache er zu Programmassistenten.
Sein Geld verdient Ivanic inzwischen ausschliesslich als Comedian, die Paragrafenreiterei trägt ihm keinen Rappen ein. Weil er mit Comedy besser verdient, oder ihm Ironie und Witz mehr Spass machen? «Ich kann die Leute einfach besser zum Lachen bringen, als sie anzuklagen oder zu verteidigen.» Er brauche aber vor allem die Emotion, die Juristerei sei reichlich trocken. Und: «Auch auf der Bühne, nicht nur über den Akten, lässt sich sehr gutes Geld verdienen – vorausgesetzt man wirft sich rein in seinen Job.»
Freispruch für die Schweiz wegen vieler Freiwilliger in Kultursektor
Dürfte Ivanic in die Rolle eines Richters schlüpfen, welches Urteil würde er über die Schweiz fällen? «30 Tagessätze – nein. Ich kann die Schweiz nicht verurteilen, sondern staune immer wieder, wie viele Bühnen, Kunstkommissionen und Freiwillige es hier gibt, damit Leute wie ich uns entfalten können.»
Er freue sich sehr auf Zofingen. «Ich lasse mich überraschen, was die Leute mir über die Stadt und die Eigenheiten seiner Bewohner zu erzählen haben. Nur Kannibalen brauche ich keine mehr – die kenne ich schon.»

Regierungsrat genehmigt Ausbau und Sanierung der Oltnerstrasse in Aarburg
Jetzt ist er da: Der Entscheid des Regierungsrats zur Sanierung und Ausbau der Oltnerstrasse in Aarburg. Der Regierungsrat hat das Projekt gutgeheissen. Damit sind auch die Einwendungen – zwölf sind während der öffentlichen Auflage im Jahr 2022 eingegangen – bearbeitet und erledigt. Erwartet worden war der Entscheid des Regierungsrats bereits Ende 2024, dann im ersten Halbjahr 2025. Aufgrund dieser Verzögerungen können die Vorarbeiten für die Sanierung und den Ausbau der Oltnerstrasse frühestens Ende 2026 starten, ab 2027 wird dann mit den Hauptarbeiten begonnen.
Im Rahmen dieses 36,6-Millionen-Franken-Projektes, das der Grosse Rat bereits im September 2022 genehmigt hat, gibt es eine neue Bussfahrspur in Richtung Olten, damit der Bus auch im Stossverkehr seinen Fahrplan einhalten kann. Um die neue Bussfahrspur zu schaffen, müssen Gebäude auf der Ostseite der Oltnerstrasse abgebrochen werden. Gleichzeitig wird auch der Strassenbelag durch einen lärmarmen Belag ersetzt.
Weitere Massnahmen sind der Umbau von zwei bestehenden Lichtsignalanlagen und der Bau von zwei neuen Anlagen. Die Lichtsignale werden als Dosieranlagen ausgestaltet, so kann der Bus bevorzugt werden und die Fussgängerinnen und Fussgänger können die Strasse einfacher queren. Um besser Abbiegen zu können, entsteht zwischen dem Knoten Höhe und der Einmündung Wartburgstrasse ein Mehrzweckstreifen. Der Fuss- und Veloweg wird neu auf einem Parallelweg geführt.
Die nächsten Schritte sind nun laut der Mitteilung des Kantons das Landerwerbsverfahren, die Submission und die Arbeitsvergabe. Die Kosten für das Grossprojekt trägt zu einem grossen Teil der Kanton Aargau: 27,6 Millionen Franken steuert der Kanton bei, 8,9 Millionen Franken muss die Stadt Aarburg bezahlen. Im Rahmen des Agglomerationsprojekts AareLand 3. Generation beteiligt sich auch der Bund an den Kosten. 7,47 Millionen Franken wurden in Aussicht gestellt. (pd)

175 Jahre voller Leidenschaft, Freundschaft und Gesang
Die Kirche Brittnau war rappelvoll – rund 300 Gäste kamen, um das Konzert mit dem Männerchor und Sandra Rippstein zu erleben. Moritz Schlanke, der bereits einen Jubiläumsanlass Ende Mai moderierte, führte erneut mit seiner gewohnten spritzigen und humorvollen Art durch den Abend.
Den musikalischen Auftakt unter der Leitung von Stefan Berger bildeten «Wellermann», das wohl derzeit bekannteste Seemannslied, und «Santiano», begleitet am Klavier von Johanna Schneider-Berger. Anschliessend hielten alle inne und gedachten Guido Distel, der den Männerchor Brittnau jahrelang geprägt hat. Ihm wurde «Griechischer Wein» gewidmet, die Kirche war mit einem grossen Strauss weisser Rosen geschmückt.
Sandra Rippstein mit Gastauftritt, Martina Bircher mit Grussworten
Sandra Rippstein trat als Erstes mit einer gefühlvollen Ballade auf, bevor sie gemeinsam mit dem Männerchor Schweizer Liedgut und weitere Stücke mit sehr viel Soul und Gefühl in der Stimme präsentierte. Begleitet wurde sie von Christoph Heule am Klavier.
Ein weiterer prominenter Gast mischte sich unter das Publikum: Regierungsrätin Martina Bircher kam mit ihrer Familie zum Konzert und richtete ein paar Grussworte an den Männerchor. Im Anschluss, oder besser gesagt vor der Zugabe, wurde den Beteiligten ein grosses Dankeschön ausgesprochen und Präsente überreicht.
Die Lieder für das Jubiläumskonzert waren sorgfältig ausgewählt worden. Alle handelten von Kameradschaft, Sehnsucht und Leidenschaft – alles Kriterien, die auf den Männerchor Brittnau zutreffen, der sich seit 175 Jahren genau dadurch auszeichnet. Musik verbindet und lässt einen die Sorgen vergessen.
Pizza-Service für den Apéro
Ein typischer Männerchor-«Kracher» folgte als zweite Zugabe. «Ein Bier» in der a-capella-Version, die gleichzeitig den Hinweis gab, dass der Apéro im Kirchgemeindehaus bereitstand. Der wurde auch rege besucht und der Männerchor hat sich etwas Pfiffiges ausgedacht, um das Publikum zu verköstigen: Etliche Schachteln mit Pizza wurden angeliefert. Die Frage, wie viele Pizzen bestellte wurden, konnte Männerchor-Präsident Kurt Gerhard nicht beantworten: «Keine Ahnung», meinte er lachend. «Ich habe einfach gesagt, sie sollen genug bestellen, damit es für alle reicht.»

Sandra Rippstein berührte mit ihrer unglaublichen Stimme. – Bild: Patrick Lüthi 
Männerchor-Präsident Kurt Gerhard (ganz links) überreichte die Präsente an (v.l.): Johanna Schneider-Berger, Stefan Berger, Christoph Heule, Sandra Rippstein und Moritz Schlanke. – Bild: Patrick Lüthi 
Rund 300 Personen nahmen an der Jubiläumsfeier in der Kirche teil. – Bild: Patrick Lüthi

VRU blickt auf stabiles Vereinsjahr zurück – und auf die neue Abfüllanlage bei Rivella
Mit einer Führung durch die Osmose- und die neue Focus-Abfüllanlage der Rivella AG startete die 51. Generalversammlung der Vereinigung Rothrister Unternehmungen (VRU). Rund 25 Teilnehmende folgten der Einladung ins Waldhaus Rothrist, wo Präsident Daniel Schöni die Versammlung offiziell eröffnete.
Die 18 anwesenden Firmen vertraten das absolute Mehr, weitere zwölf hatten sich entschuldigt. Auf der Traktandenliste standen wie gewohnt Jahresrechnung, Wahlen und ein Ausblick auf kommende Aktivitäten – allerdings ohne grosse Neuerungen. Der VRU wolle im nächsten Jahr keine neuen Projekte anstossen, erklärte Schöni. Man konzentriere sich darauf, Schulden abzubauen und die finanzielle Basis zu stärken.
Solide Jahresrechnung und Pumptrack als Grossprojekt
Kassier Philipp Christen präsentierte eine ausgeglichene Jahresrechnung 2024 mit einem Gewinn von 15’984 Franken. Insgesamt seien Mitglieder- und Sozialbeiträge in der Höhe von 24’153 Franken eingegangen, erläuterte er. Die Revisoren Felix Schönle und Roberto Romano bestätigten eine einwandfreie Buchführung und beantragten die Entlastung von Vorstand und Kassier – der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Ein grosser Posten in der Vereinsrechnung bleibt der im vergangenen Jahr realisierte Pumptrack. Das Gemeinschaftsprojekt für Jung und Alt kostete insgesamt 213’761 Franken. Dank Beiträgen von Swisslos und dem TCS in Höhe von 40’556 Franken sowie Sachleistungen der Firmen Hallwyler AG und Schöni AG über 25’530 Franken konnte der VRU einen wesentlichen Teil selbst tragen. Hinzu kamen wie jedes Jahr gemeinnützige Beiträge, etwa 4000 Franken an das Alters- und Pflegeheim Luegenacher.
Stabilität im Vorstand
Die Wahlen verliefen ohne Überraschungen: Sämtliche Vorstandsmitglieder stellten sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung und wurden im Globo mit Applaus bestätigt. Auch Präsident Daniel Schöni erhielt das Vertrauen der Mitglieder und wurde für zwei Jahre wiedergewählt. Als Revisoren amten weiterhin Felix Schönle und Roberto Romano.
Der Mitgliederbestand der VRU ist leicht rückläufig. Nach den Austritten der Bevero AG und der Bouygues E&S In Tec zählt die Vereinigung derzeit 29 Mitglieder. Neue Eintritte gab es keine.
Nach dem formellen Teil berichteten Thomas Fischer und Roberto Romano über die aktuelle Lage in ihren Unternehmen Fischer Rohrleitungsbau AG und EW Rothrist AG. Beim anschliessenden Nachtessen – organisiert vom Team des Alterszentrums Luegenacher – blieb Zeit für Austausch und Geselligkeit. Die nächste Generalversammlung findet am 29. Oktober 2026 statt, wiederum im Rahmen des traditionellen Treffens mit den Gemeindebehörden.

«De Faxetüüfu»: Fernöstliche Magie auf der Theaterbühne in Reiden
Theater ist Leidenschaft. Dies empfand man vor langer Zeit auch in Reiden so. Aus einer zunächst losen Theatergesellschaft wurde 1865 der heutige Verein. Jedes Jahr bringt er seither ein Stück zur Aufführung, dies stets im Saal des örtlichen Hotels Sonne. Am Freitag erfolgte die Premiere zu «De Faxetüüfu». Es handelt sich dabei um ein altes japanisches Märchen, das mit den Motiven des Verlassenwerdens und der Ausgrenzung spielt, eine Parabel um die Begriffe wahre Liebe und Selbstlosigkeit bildet und somit sehr in die heutige Zeit passt.
Ein Stück mit viel Magie
«De Faxetüüfu», ein Stück in vier Akten für kleine und grosse Kinder ab sechs Jahren, wurde von Stefan Wieland geschrieben, der auch Regie führt. Zum Inhalt: Yuki, ein blindes Mädchen (Anna Graf), wächst ohne Mutter, dafür mit einem sehr strengen Vater (Roland Höltschi) auf. Die Dorfgemeinschaft, insbesondere die Gören Akiko (Anna Ossola) und Keiko (Yanina Ossola) machen es dem frohen Mädchen jedoch sehr schwer, ihr Leben zu leben: Stets wird sie gehänselt und ausgelacht.
Da begegnet sie, eher unfreiwillig, dem «Faxetüüfu» Bekkanko (Jonas Stanger), einem Aussenseiter in der Welt der Teufel. Dieser verliebt sich unsterblich in das blinde Mädchen und ist bereit, sogar sein Leben zu opfern, um Yuki das Augenlicht zurückzugeben. Welche Rolle dabei die Tiere des Waldes (Roland Brauchli, Urs Hug, Barbara Leu, Elena Ossola und Monika Gassmann in Dreifachrollen) sowie die göttliche Bergmutter (Rita Stanger) spielen, sei hier nicht verraten. Aber: Die Magie nimmt einen grossen Platz in diesem Stück ein.
Nach der erfolgreichen Premiere folgten am Samstag und Sonntag zwei weitere Aufführungen. Wer all dies verpasst hat, erhält dennoch Gelegenheit, sich dieses Märchens zu erfreuen. Die weiteren Aufführungstermine können der Homepage der Theatergesellschaft (www.theaterreiden.ch) entnommen werden. Zudem wartet abends ein reichhaltiges kulinarisches Angebot auf die Gäste.

Ebenfalls Aussenseiter: Bekkanko wird von den anderen Teufeln nicht ernst genommen. – Bild: Julia Höltschi 
Yuki und Bekkanko: Die beiden Aussenseiter finden zueinander. – Bild: Julia Höltschi 
Strenger Vater: Er führt Yuki ans Grab ihrer Mutter. – Bild: Julia Höltschi 
Aussenseiterin: Akiko und Keiko (links) lachen die blinde Yuki aus. – Bild: Julia Höltschi 
Erfolgreich: Die Crew erntete viel Applaus für ihre Aufführung. – Bild: Julia Höltschi